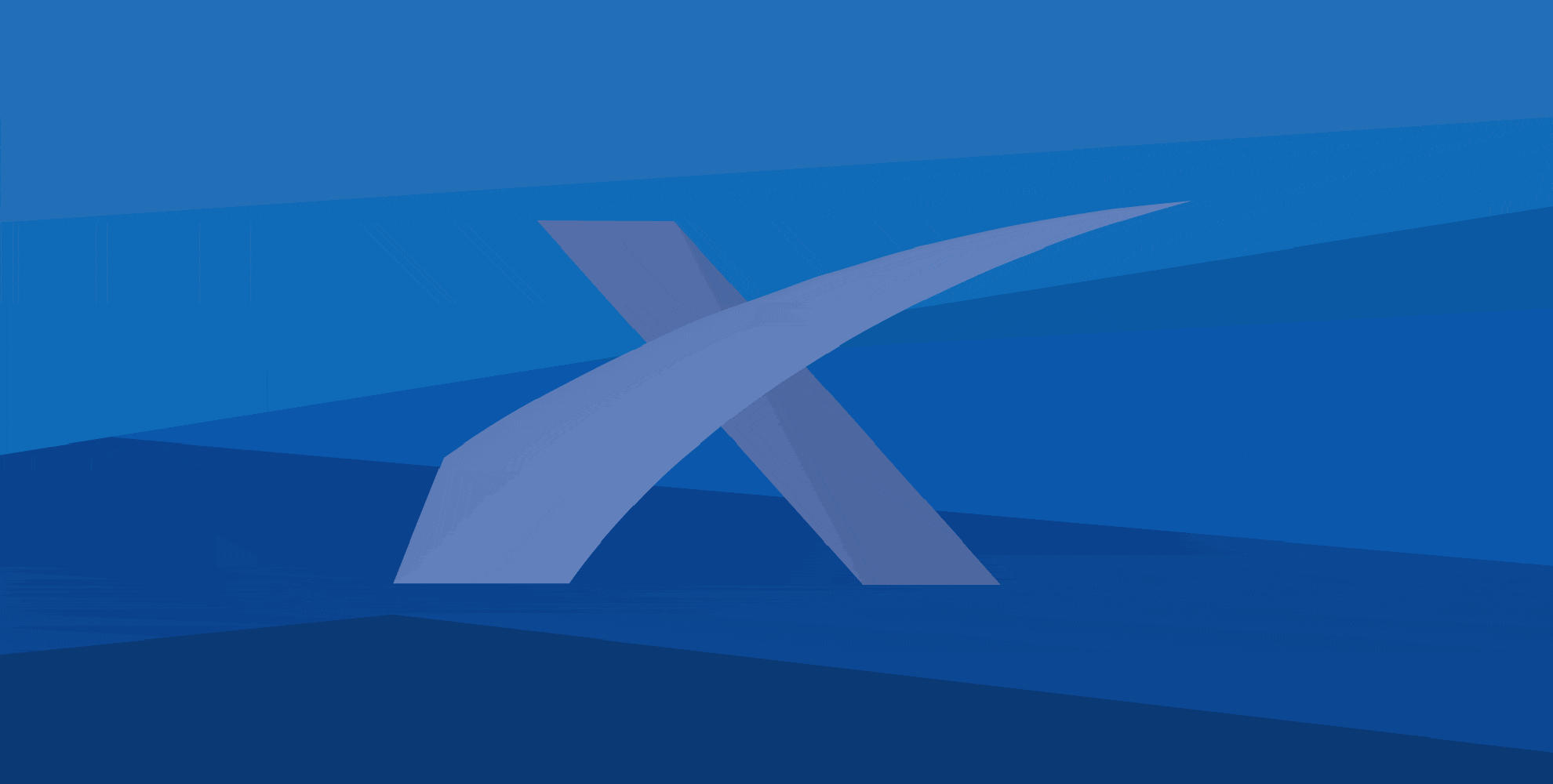Prof. Klaus Zuberbühler
Prof. Dr. Klaus Zuberbühler, Jahrgang 1964, studierte an der Universität Zürich Zoologie. Der kürzlich verstorbene Professor Hans Kummer, ein international bekannter Verhaltensforscher, inspirierte ihn, sich dem Thema Verhaltensforschung und Kommunikation von Primaten zu widmen. Seine Forschungsarbeit und Feldarbeit führten in diverse Urwälder weltweit. Zuberbühler forschte lange Jahre in den USA und in Schottland und ist seit 2012 Professor an der Universität Neuchâtel. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört das Analysieren der Sprache unserer Artverwandten, den Primaten. Seine bahnbrechenden Forschungsresultate erlauben Rückblicke in die Vergangenheit und die Entwicklung auch der Sprache der Menschen. Mit komplexen Experimenten mit beispielsweise Schimpansen, Bonobos und Meerkatzen konnten er und seine Forschungsteams aufzeigen, dass die Primaten über eine Sprache verfügen und ein grosses Verständnis für ihre oft sehr komplexen sozialen Umgebungen haben. Im Interview mit Christian Dueblin berichtet Professor Zuberbühler von seinen Forschungsarbeiten, zeigt auf, wie Primaten kommunizieren und was wir dabei für Rückschlüsse auf die Evolution der menschlichen Sprache ziehen können. Er stellt aber auch fest, dass die Primaten-Populationen am Schrumpfen sind und – obwohl oft kleinere Geldbeträge schon ausreichen würden – mangels Geld nicht rettend eingegriffen werden kann. Professor Zuberbühler schliesst nicht aus, überhaupt der letzten Generation von Forschern anzugehören, die noch vor Ort im Urwald Menschenaffen beobachten und erforschen können.
Dueblin: Sehr geehrter Herr Professor Zuberbühler. Sie haben an der Universität Zürich Zoologie studiert und sind aufgrund einer Semesterarbeit, inspiriert vom kürzlich verstorbenen Verhaltensforscher Professor Hans Kummer, in die Verhaltensforschung von Affen, sogenannten Primaten, eingestiegen. Seither waren Sie lange Zeit in den USA, haben über 10 Jahre in Schottland gelebt und geforscht und gehören mittlerweile zu den renommiertesten Forschern in Bezug auf die Erforschung der Sprache der Affen und der Evolution der menschlichen Sprache. Was hat Sie damals veranlasst, sich diesem Thema zu widmen?
Prof. Dr. Klaus Zuberbühler: Der Beginn meiner Karriere als Verhaltensforscher auf dem Gebiet der Primaten verdanke ich dem von Ihnen genannten Professor Hans Kummer. Ich bekam während meinem Studium in Zürich anlässlich meiner Diplomarbeit von ihm die Möglichkeit, an der Elfenbeinküste eine Diplomarbeit in Verhaltensforschung zu schreiben. Die Wahl der Kommunikation von Affen war ein purer Zufall.
Damals wusste man aufgrund von Forschungsarbeiten an Meerkatzen, dass diese für verschiedene Fressfeinde verschiedene Alarmrufe brauchten. Hans Kummer war ein Begründer und Pionier in dieser Forschungsrichtung. Das war damals aber das einzige erforschte Beispiel von simpler Tier-Semantik. Zu meiner Fragestellung gehörte es damals, herauszufinden, ob es auch andere Arten von Affen gab, die ähnliche oder gleiche sprachliche Verhaltens- und Kommunikationsmuster an den Tag legten. Ich untersuchte die Diana-Meerkatzen und schon bald erkannten wir, dass diese auch Alarmrufe, beispielsweise für Leoparden oder Adler, also die typischen Fressfeinde, brauchten. Es stellte sich alsdann auch die spannende Frage, ob es Zusammenhänge zwischen diesen Affenrufen und der menschlichen Sprache gibt. Eines der Hauptmerkmale der menschlichen Sprache ist, dass sie referenziell ist und eine bedeutungsvolle Semantik, also ein „Lexikon“, hat. Wir stellten bei den Forschungsarbeiten fest, dass die Affen für verschiedene Lebensumstände verschiedene Rufe benutzen. Ein Ruf allein sagt jedoch noch nichts über seine Bedeutung aus. Es muss zuerst der Zusammenhang zwischen dem Ruf und dem auslösenden Ereignis beschrieben werden.
Dueblin: Was denken Sie, sind die Gründe, warum man erst seit wenigen Jahren erkannt hat, dass die Affen eine Sprache haben und in Bezug auf viele Lebenssachverhalte kommunizieren können? Sind es technische Fortschritte, die solch späte Erkenntnisse ermöglicht haben, oder bestand einfach das Interesse nicht, sich mit der Sprache der Affen auseinanderzusetzen?
Prof. Dr. Klaus Zuberbühler: Die Technik war sicher ein Hauptgrund dafür, dass gewisse Erkenntnisse erst sehr spät gemacht worden sind. Man hat früher, weil die Technik zu wenig weit war, die Laute und Rufe mit mechanischen und aufwändigen Methoden analysiert. Es gab sogenannte Sonographen, die mit Papier funktionierten. Man musste damals aber mit dem Lineal messen und hantieren. Als ich anfing, kamen erste Computer-Programme auf den Markt und die digitale Vermessung wurde möglich. Das hat zu grossen Forschungsdurchbrüchen geführt. Plötzlich war es möglich, bei Rufen von Affen subtile Unterschiede zu erkennen, die vorher nicht erkennbar waren. Menschen, die vor diesem digitalen Zeitalter Affen und ihre Rufe studierten, konnten gewisse Nuancen mangels Technik einfach nicht erkennen.
Der Mensch hat aber schon vorher Sprach- und Kommunikationsverhalten von Tieren erforscht. Ein schönes Beispiel ist der deutsche Forscher Karl von Frisch, der die Bienentänze analysiert hat und bahnbrechende Forschungsresultate erzielte. Auch über die Sprache von Delphinen wurden viele Forschungen betrieben. In Bezug auf die Sprache der Primaten hat man sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem darauf konzentriert, herauszufinden, ob beispielsweise Affen etwas beigebracht werden kann. Es ist immer wieder versucht worden, Schimpansen die menschliche Sprache beizubringen. Affen wurden dafür von Geburt auf von Menschen aufgezogen, wie ein Kleinkind. Diese Affen, die unter Menschen aufwuchsen, lernten zwar zu imitieren und sie konnten sogar Tätigkeiten im Haushalt nachmachen. Es hat aber kein Tier angefangen, Laute wie ein Kleinkind zu produzieren. Dann versuchte man herauszufinden, ob man Affen eine Art Taubstummensprache lehren kann. Man lehrte sie, sich mit Gesten und abstrakten Lexigrammen auszudrücken. Der bekannte Bonobo-Affe Kanzi hat gezeigt, dass Affen diesbezüglich sehr viel lernen können. Er kennt hunderte von Symbolen und kann sich erstaunlich gut ausdrücken. Im Freiland hingegen gab es nur wenig Versuche, das natürliche Kommunikationsverhalten zu beschreiben.
Dueblin: Man hört und liest immer wieder, dass der aufrechte Gang des Menschen, sein tiefliegender Kehlkopf, die Bewegungen der Lippen und der Zunge dem Menschen das Sprechen ermöglichen würden, physische Voraussetzungen und Merkmale, die ein Affe nicht aufweist. Auch unterscheiden sich Primaten genetisch vom Menschen. Würde ein Affe denn sprechen können, wenn er die physischen Voraussetzungen, wie sie der Mensch offenbar hat, hätte?
Prof. Dr. Klaus Zuberbühler: Der Kehlkopf des Menschen liegt permanent tief. Es ist immer wieder behauptet worden, dass der Vokalapparat des Menschen anders gebaut sei und beispielsweise Affen deshalb gar nicht fähig seien, Laute, wie sie der Mensch produzieren kann, von sich zu geben. Man schloss daraus, dass nur Menschen ein reichhaltiges Repertoire an Lauten erzeugen können. Es gibt heute aber neue Erkenntnisse und Forschungsresultate, die diese These in Frage stellen. Es konnte überzeugend aufgezeigt werden, dass das nicht durchgehend stimmt. Der Evolutionsbiologe Tecumseh Fitch hat einen Krokodil-Vokaltrakt studiert und aufgezeigt, dass ein Krokodil durchaus fähig wäre, Laute von sich zu geben, wie das der Mensch kann. Das Krokodil ist immerhin ein Reptil, das in Bezug auf die Abstammung des Menschen weit von ihm entfernt ist. Das zeigt, dass es nicht nur auf den Bauapparat des Vokaltraktes ankommt, sondern vor allem auf seine Ansteuerung durch das Gehirn. Man kann Schimpansen durchaus beibringen, die Lippen willentlich zu bewegen und man kann sie auch trainieren, mit dem Mund Töne zu erzeugen. Was ihnen grosse Schwierigkeiten bereitet, ist die Stimmlippen am Kehlkopf gleichzeitig und willentlich zu aktivieren. Wahrscheinlich fehlt es an den nötigen Nervenbahnen, die den Kehlkopf und Vokalapparat beim Menschen ansteuern.
Dueblin: Der Schimpanse scheint dem Menschen genetisch sehr nahe zu stehen. Wie steht der Mensch in Sachen Abstammung zu den Primaten, die Sie heute erforschen?
Prof. Dr. Klaus Zuberbühler: Auch die Affen, die wir kennen, haben Vorfahren. Viele Affenarten sind im Verlaufe der Zeit ausgestorben. Man kann heute aber zurückrechnen, wann wir die gleiche Vorfahren-Art hatten. Wir wissen heute mit Bestimmtheit, dass die gemeinsamen Vorfahren der Schimpansen und der Menschen vor rund 6 bis 8 Mio. Jahren gelebt haben. Zuvor gehörten wir, die Vorfahren der Menschen und Schimpansen, einer Art an. Man geht davon aus, dass unsere gemeinsamen Vorfahren wohl eher einem Schimpansen ähnlich waren als einem Menschen. Aus Gründen, die wir nur vermuten können, hat sich die Population dann in zwei getrennt. Eine Hälfte ging in Richtung Savanne und eine Hälfte blieb im Wald. Seither haben sich auch diese beiden Hälften wieder enorm verändert. Man kann also nicht sagen, dass der Schimpanse unser Vorfahre war. Wir wissen auch nicht, wie er vor 6 Mio. Jahren ausgesehen hat, weil die entsprechenden Fossilien noch nicht gefunden worden sind. Die Schimpansen und Bonobos sind für uns aber sehr interessant, da sie unsere nächsten Verwandten darstellen.
Dueblin: Diverse Funde beweisen, dass unsere Vorfahren schon vor 2 Mio. Jahren mit Steinwerkzeugen arbeiteten, Feuer machten und weitergeben konnten. Daraus leitet man ab, dass sie miteinander kommunizieren konnten. Was weiss man heute darüber?
Prof. Dr. Klaus Zuberbühler: Es sind von frühen Menschenformen primitive Werkzeuge gefunden worden. Sie zeigen, dass diese Frühmenschen offenbar schon gewisse abstrakte Ideen hatten, wie ein Werkzeug aussehen muss, damit es auch funktioniert. Es darf daraus abgeleitet werden, dass diese Frühmenschen voneinander gelernt und ihr Wissen und ihre Tradition weitergegeben haben. Wir finden dieses Vermitteln von Wissen in einfacher Form beispielsweise auch bei den Schimpansen. Es gibt Populationen in Westafrika, die Nüsse mit einer Art Amboss knacken können, der über Generationen hinweg gebraucht worden ist. Diese Amboss-Nuss-Knackstelle wurde offensichtlich von einer zur nächsten Generation weitervermittelt. Es gibt auch Affen, die Stockwerkzeuge herstellen. Sie brechen einen Stock ab und bearbeiten ihn am einen Ende mit dem Mund und den Zähnen, so dass dieses Ende des Stockes einem Pinsel gleicht. Den Stock stecken sie dann in einem Bienenstock und holen so den Honig raus. Dieses Verhalten ist offensichtlich auch von Generation zu Generation weitergegeben worden. Unsere Studiengruppe in Uganda beobachtet nun seit 25 Jahren Affen und dort ist noch nie ein Stockgebrauch gesehen worden. Es hatte dort offenbar bisher kein Affe die Idee gehabt, einen Stock zu nehmen und ihn zurechtzubeissen, so dass er für das Gewinnen von Honig brauchbar wäre.
In Zusammenhang mit der Sprache kann in Bezug auf den Menschen festgestellt werden, dass die Gespräche, die Menschen in der Regel beschäftigen, fast immer um soziale Themen kreisen. Im Vergleich dazu sind Gespräche, in denen es beispielsweise darum gehen könnte, wie man einen Stock bearbeitet oder ein Steinwerkzeug herstellt, vernachlässigbar. Wenn Sprache also funktional etwas bringt, so doch meistens im sozialen Bereich und nur selten in Bezug auf konkrete Überlebensfragen. Die Sprache ist also für das Lernen im Umgang mit einem Steinwerkzeug nicht zwingendermassen Voraussetzung, ohne die Wissen nicht vermittelt werden könnte.
Dueblin: Das heisst also, dass man aus Werkzeugen oder auch aus der Weitergabe von Feuer nicht unbedingt schliessen kann, dass sie mit einer Sprache gekoppelt waren?
Prof. Dr. Klaus Zuberbühler: Ja, denn die Evolution der materiellen Kultur ist wohl eher unabhängig von Kommunikation zu erklären. Auch das Argument der Jagd wird übrigens immer wieder herbeigezogen, um zu zeigen, dass diese ohne Kommunikation nicht möglich sei. Beobachten wir aber Schimpansen im Wald, dann erkennt man, dass sich die Affen anschauen, ein Verständnis dafür haben, wie sich die Beutetiere verhalten und es keiner weiteren Kommunikation bedarf, um gemeinsam Jagen zu können. Umgekehrt stellen wir aber klar fest, dass es im sozialen Gefüge Kommunikation bedarf, dann beispielsweise, wenn es darum geht, welcher Affe mit wem etwas haben oder machen soll. Solche Lebenssachverhalte bei Affen resultieren oft in grossem Geschrei, sprich Kommunikation. Das deutet darauf hin, dass die Sprachentwicklung im sozialen Kontext stattgefunden hat.
Dueblin: Das schliesst aber nicht aus, dass es schon vor 2 Mio. Jahren aufgrund sozialer Lebensumstände Kommunikation, in Form einer Sprache, zwischen unseren Vorfahren gegeben hat.
Prof. Dr. Klaus Zuberbühler: Das wäre dann die nächste Frage. Wenn man heute die Schimpansen beobachtet, so erkennt man, dass sie in ihrem Sozialverhalten hochkomplex veranlagt sind. Sie leben in lebenslangen familiären Beziehungen und unterstützen sich gegenseitig. Es darf davon ausgegangen werden, dass unsere Vorfahren auch so funktioniert haben und die gleichen sozialen Probleme und Chancen schon vor 2 Mio. Jahren herrschten. Es fragt sich aber, was auf der Menschenseite passiert ist, dass sich der Mensch so schnell und massiv sprachlich weiterentwickeln konnte. Affen sind in ihrer Kommunikation, verglichen mit dem Menschen, relativ einfach. Das hochpräzise Hervorbringen von Lauten und das Zusammensetzen dieser Laute in langen Ketten, die etwas bedeuten, sind für den Menschen einmalig.
Dueblin: Hat die Sprachentwicklung des Menschen mit seiner Fähigkeit Verallgemeinern und Abstrahieren können zu tun?
Prof. Dr. Klaus Zuberbühler: Wenn man die Kommunikation des Menschen beschreibt, so ist das ein ganz wichtiger Faktor, die dem Menschen eigen ist und ihn von Tieren ganz wesentlich unterscheidet. Es gibt aber viele andere Dinge, die der Mensch auch kann. Er kann nebst vielem mehr auch in die Zukunft schauen und sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Es gibt eine ganze Reihe von weiteren kommunikativen Fähigkeiten des Menschen, die man bei Tieren sicher nicht im selben Ausmass antrifft. Es ist oft verführerisch, einfach nur ein Element herauszugreifen. Sicher kann man aber sagen, dass bei der menschlichen Evolution das Gehirn im Vergleich zum Körper unheimlich viel grösser geworden ist und der Mensch eigentlich eine Art „Ballonkopf“ hat, verglichen beispielsweise mit den Affen, die in Bezug auf die Köpergrösse ein viel kleineres Hirnvolumen aufweisen. Ein Schimpanse hat rund 500 Kubikzentimeter Hirnvolumen. Beim Menschen sind es zwischen 1300 und 1500 Kubikzentimeter, obwohl das Gewicht beider Lebewesen ähnlich ist. Beim Gorilla ist das noch extremer. Er kann fast 200 Kilogramm auf die Waage bringen und hat lediglich ein Gehirnvolumen von etwa 500 Kubikzentimetern. Mit so einem grossen Hirn, wie es der Mensch hat, sind viel komplexere Prozesse im Hirn möglich. Wie es aber schliesslich zur Sprachentwicklung kam, ist die grosse Frage und wir Forscher versuchen, diese Frage zu beantworten. Eine „hippe“ Hypothese beruht auf der Tatsache, dass wir sehr kooperativ geworden sind. Bei Schimpansen ist dieses Kooperationsvermögen nur ansatzweise anzutreffen. Sie leben auch mit Affen aus ihrer Population, die ihnen näher und weniger nahe stehen. Das hochgradige Kooperationsverhalten, wie wir es beim Menschen erkennen können, gibt es beim Schimpansen aber nicht.
Dueblin: Es wird also vermutet, dass die Kooperationsfähigkeit des Menschen auf seiner Sprache beruht?
Prof. Dr. Klaus Zuberbühler: Man geht davon aus, dass wenn man ein kooperatives Leben führt, wie das der Mensch tut, man auch untereinander interagieren können muss. Die Menschen erarbeiten beispielsweise Dinge zusammen. Das tun zwei Schimpansen nicht. Wir beide sitzen beispielsweise hier in diesem Raum, sprechen miteinander und es entsteht etwas, das wir gemeinsam anpeilen oder wollen. Sie können aber nicht zwei Schimpansen in einen Raum sperren und sich erhoffen, dass sie das auch so machen. Das Zusammenbringen der beiden Affen würde eher in einem Chaos resultieren. Mit der neuen und kooperativen Lebensart reichte das alte Kommunikationssystem, das auf bestimmten Rufen oder auf Gestik basiert hat, nicht mehr aus. Es bedurfte besserer Kommunikation, um gemeinsam überleben zu können.
Dueblin: Was war denn für die Kooperation zwischen Menschen oder unserer Vorfahren ausschlaggebend?
Prof. Dr. Klaus Zuberbühler: Alle grossen Menschenaffen sind Waldtiere. Auch die meisten anderen Affen sind Waldtiere. Menschen sind mit dem zweibeinigen Gang nicht für das Leben im Wald, sondern für das Leben in der Savanne geeignet. Sie müssen im Gras laufen und gut sehen, also die Übersicht auf weitem Gelände haben. Im offenen Gelände ist das Leben in der Regel schwieriger als im Wald. Man sieht das auch bei Säugetieren, die in der Savanne leben. Sie werden oft kooperativ, müssen kooperativ sein, um überleben zu können. Die Erdmännchen sind ein gutes Beispiel: Ihr Leben im Freien ist gefährlich und die Nahrungssuche ist schwieriger als im Wald. Die Schimpansen sind immer am „Rumtouren“ und wissen genau, wo und wann es etwas zu essen gibt. Mehr müssen sie nicht wissen. Die Nahrungsmittel in der Savanne sind hingegen weiter verteilt. Hat man in der Savanne gejagt, geht man zurück und teilt die Nahrung abends zuhause auf. Die Anforderungen dieses Lebensstils sind viel komplizierter und erfordern eine bessere Kommunikation.
Dueblin: Was sind heute die wesentlichen Erkenntnisse Ihrer Forschung in Bezug auf den Menschen und seine Sprachentwicklung?
Prof. Dr. Klaus Zuberbühler: Für mich und meine Arbeitsgruppe ist die grosse Frage, wie es zur menschlichen Sprache kam, wie sie sich entwickelt hat. Man kann mangels Fossilien die Sprachevolution nicht direkt studieren. Es geht um Verhalten, das sich nicht einfach im Knochenbau widerspiegelt. Man kann aber das Kommunikationsverhalten des Menschen mit dem der Affen vergleichen. Der Schimpanse hat zwar keine Sprache in unserem Sinn. Wir versuchen jedoch anhand der Affen und ihrem Kommunikationsverhalten, die Grundbausteine zu erkennen, damit sich eine Sprache überhaupt entwickeln kann. Ein solcher Baustein ist die Fähigkeit, Bedeutungen verschiedener Laute zuordnen zu können. Ein Kind, das auf die Welt kommt, hat anfänglich keine Ahnung von der Sprache. Es versteht aber sehr schnell, dass gewisse Laute immer dann zu hören sind, wenn etwas Bestimmtes passiert. Es lernt ständig, Laute Lebenssachverhalten zuzuordnen. Mit Experimenten rund um Primaten kann man aufzeigen, dass Affen über solche Grundbausteine, die für die Entwicklung der Sprache wichtig sind, verfügen. So kann ein Affe beispielsweise, hat er einmal einen Vogel gesehen, der einen Adleralarmruf von sich gegeben hat, später nur schon aufgrund des Rufes des Vogels und ohne einen Adler zu sehen, erkennen, dass ein Adler in der Umgebung ist. Das beweist, dass die Fähigkeit, gewisse Laute zuordnen zu können, bei den Primaten weit verbreitet ist. Der Affe versteht also den Zusammenhang zwischen Signal X und Ereignis Y und passt sein Verhalten an.
Interessant sind die Versuche, in denen man beispielsweise einem Affen einen Adleralarm vorspielt. Der Affe reagiert und gibt den Alarm mit seinen eigenen Rufen an die anderen Affen weiter. 5 Minuten später spielt man die Schreie eines Adlers ab. Nun zeigt es sich, dass der Affe, wenn er den Vogelschrei hört, selber keine Alarmrufe mehr gibt. Das lässt sich nur so begründen, dass der Affe schon weiss, dass ein Adler hier ist. Er ist also nicht mehr überrascht. In der Kontrollsituation spielt man dann das Brüllen eines Leoparden ab und sofort fängt der Affe wieder an, die anderen zu warnen. Der Affe hat also ein Bild der verschiedenen Fressfeinde in seinem Kopf. Das alles zeigt, dass es wohl eher so ist, dass die Alarmrufe mit komplexen mentalen Repräsentationen der verschiedenen Ereignisse verbunden sind.
Auch stellt sich die Frage der Syntax, die dem Menschen eigen ist. Die menschliche Sprache ist syntaktisch organisiert. Wir sagen nicht nur einzelne Wörter, sondern kombinieren diese und bauen komplexe Sätze daraus. Bei Affen gibt es auch hier Beispiele, die interessante Erkenntnisse hervorgebracht haben. Man hat herausgefunden, dass ein Ruf in Serie etwas ganz anderes bedeutet, als derselbe Ruf in einer Kombination von Rufen. Es scheint auch dieses Sprachverhalten ein wichtiger Baustein zu sein, der offenbar schon immer in diesen Lebewesen drin war. Der Baustein ist vom Menschen im Laufe der Zeit sehr modifiziert worden und die Syntax zeichnet heute unsere Sprache aus.
Dueblin: Sie forschen auf der ganzen Welt und treffen manchmal auf die gleichen Arten von Affen in benachbarten Gebieten. Gibt es Parallelen oder Gemeinsamkeiten in der Sprache zwischen diesen Populationen, die Ihnen aufgefallen sind?
Prof. Dr. Klaus Zuberbühler: Das ist eine sehr interessante Frage. Wir haben, um die Frage beantworten zu können, mit Diana-Meerkatzen Versuche gemacht. Wir verglichen eine Population dieser Affenart an der Elfenbeinküste, die in relativ natürlichen Verhältnissen lebt, und eine andere Population auf einer Insel in Sierra Leone in Bezug auf ihre Alarmrufe. Auf der Insel in Sierra Leone gibt es noch Adler, aber schon lange keine Leoparden mehr. Es ist also ausgeschlossen, dass Affen dort schon einmal einen Leoparden hätten schreien hören können. Wir haben diesen Affen einen Leopardenschrei vorgespielt. An der Elfenbeinküste fangen die Affen sofort an, spezifische Leoparden-Warnschreie zu produzieren. Auf der Insel in Sierra Leone hat kein einziger Affe einen Leoparden-Warnschrei von sich gegeben. Sie haben nur einen generellen Alarmruf von sich gegeben, den sie aber auch verbreiten, wenn etwas Unspezifisches passiert, beispielsweise ein Baum umfällt oder ein Gewitter hereinbricht. Das lässt darauf schliessen, dass ein Lernprozess stattgefunden hat. Der Affe muss zuerst den Leoparden als relevanten Feind kennenlernen.
Dueblin: Im Dschungel kommt es beim Beobachten unserer Verwandten sicher auch zu komischen Situationen. Muss man manchmal, wenn man aus dem Urwald zurückkommt, innerlich etwas lachen, wenn man unsere Gesellschaft anschaut und vielleicht auch Parallelen zu menschlichem Verhalten entdeckt?
Prof. Dr. Klaus Zuberbühler: (Lacht) Ja, das gibt es sicher, vor allem in Bezug auf das Sozialverhalten: In einer Schimpansen-Gruppe gibt es alle 10 bis 15 Jahre einen Rangwechsel. Es kommt ein neuer Chef zum Zug. Wir sagen ihm „Alpha-Männchen“. Am Anfang ist er sehr aggressiv, geht auf andere los, oft auch ohne Grund. Es macht den Anschein, er habe Schwierigkeiten, sich in seiner neuen Position zu etablieren. Das sind sicher Verhalten, die man auch in unserer Gesellschaft entdeckt oder meint entdecken zu können. Dann ist es sicher auch das Sexualverhalten der Menschen und der Primaten ganz ähnlich. Die verschiedenen Strategien, wie Männchen versuchen, die Weibchen zu überzeugen, sich auf sie einzulassen und die Versuche, andere Männchen zu vertreiben, sind bei uns Menschen ganz ähnlich. Es ist verführend solche Parallelen zu beschreiben und sie zu deuten zu wollen. Wollte man das alles besser wissen und genauer verstehen, und generalisierend feststellen, so müsste man Studien machen und mit Experimenten versuchen, diesen Zusammenhängen näher auf den Grund zu gehen.
Dueblin: Ihre Doktoreltern aus den USA, D.L. Cheney und R.M. Seyfarth, haben auch in Sachen soziales Verhalten geforscht und dabei festgestellt, dass es verschiedenste soziale Verhaltensarten zwischen verschiedenen Arten von Affen gibt. Wie funktionieren Affenfamilien und Affengesellschaften?
Prof. Dr. Klaus Zuberbühler: Es kommt bei dieser Frage sehr auf die Affenart an. Interessant sind in Bezug auf diese Frage die Schimpansen, die aber auch gleich eine Ausnahme darstellen. Junge Schimpansen-Weibchen, die 12 bis 14 Jahre alt sind, gehen von der Gruppe weg und schliessen sich anderen Gruppen an. Die Männchen bleiben und bilden starke Bezüge zueinander. Die jungen Weibchen gründen ihre eigene Familie in einer anderen Gruppe. Bei den meisten anderen Affen-Arten ist das genau umgekehrt. Dort bleiben die Weibchen in der Gruppe und die Männchen gehen in einem bestimmten Alter weg und schliessen sich einer neuen Gruppe an. Wo die Weibchen bleiben, spricht man im Fachjargon auch vom „Matriarchat“. Matriarchale Verhältnisse herrschen beispielsweise bei den Pavianen. Dort sind klare Rangverhältnisse zwischen den verschiedenen Mütter-Linien zu beobachten. Man könnte das mit einem Kastensystem vergleichen. Es gibt sehr angesehene Mütter-Linien und weniger angesehene. Robert Seyfarth und sein Team hat bei der Erforschung dieser Zusammenhänge phantastische Erkenntnisse gewinnen können. Er hat in Experimenten Rangveränderungen simuliert. So provozierte er Affen einer rangtieferen Linie, einen Aggressionsruf an Affen einer ranghöheren Linie zu richten. Das dürften Affen einer rangniedrigeren Linie nicht tun. Geschehen solche Aggressionsrufe innerhalb ein und derselben Mutter-Linie, passiert nicht viel. Passieren solche Aggressionsrufe aber zwischen verschiedenen Mutter-Linien, so führt das zu Problemen. Die Affen wissen also sehr gut um die sozialen Konsequenzen ihres Verhaltens innerhalb und ausserhalb der eigenen Linie.
Dueblin: Professor Zuberbühler, was sind die Forschungsprojekte, die Sie zurzeit im besonderen Mass beschäftigen und was würden Sie gerne in nächster Zeit noch angehen?
Prof. Dr. Klaus Zuberbühler: Nebst Semantik und Syntax, die die menschliche Sprache ausmachen, haben wir Menschen ein ausgeprägtes Mitteilungsbedürfnis. Wir wollen uns äussern und mit dem Geäusserten auch etwas bezwecken. Bei den Schimpansen ist nicht so klar, ob sie einen Ruf produzieren, um damit eine spezifischen Zweck beim Zuhörer zu erzeugen. Wenn sie einen Leopard sehen, dann geben sie Laute von sich. Die Frage ist nun, ob es ihnen aber egal ist, was der Effekt beim Zuhörer ist und was dieser mit der Information macht. Wir versuchen nun mit Verhaltensexperimenten mit Schimpansen, Pavianen und Meerkatzen herauszufinden, wie bewusst sich diese Primaten in Bezug auf die Effekte auf die Zuhörerschaft sind. Wir erforschen zurzeit, ob sie mit Rufen etwas bewirken wollen, oder sie nur eine Reaktion auf die Umwelt darstellen. Bei den Schimpansen wissen wir bereits, dass sie relativ spezifisch sind. Sie unterdrücken oft auch Rufe, wenn sie merken, dass diese in negativen Konsequenzen im sozialen Umfeld resultieren können. Das alles sind Fragestellungen, die uns bis zu ihrer Klärung noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden.
Dueblin: Was wünschen Sie sich persönlich und für die Forschung rund um die Primaten?
Prof. Dr. Klaus Zuberbühler: Es ist erschreckend und es stimmt mich sehr traurig zu sehen, wie die Primaten-Populationen zusammenkrachen, aufgrund von menschlichen Einflüssen. Die Habitate werden immer kleiner, es gibt Krankheiten, die eingeschleppt werden und es wird abgeholzt und gewildert. Es ist schwierig, kleine Beträge zu mobilisieren, die nötig wären um diesen Populationen helfen zu können. Unsere Erfahrung ist, dass dort, wo es Forschungsstationen hat, die Primaten sicherer leben können. Oft ist das nicht mit viel finanziellem Aufwand verbunden. Die lokale Bevölkerung ist in der Regel immer interessiert, an dem was wir machen. Sie respektiert uns und mancher findet aufgrund unserer Tätigkeit auch eine Beschäftigung. Die Wilderei hört dann oft auf, auch das Holzfällen. Der beste Schutz ist immer dann gewährleistet, wenn jemand vor Ort, mit den Tieren arbeitet und mit der lokalen Bevölkerung eine Beziehung aufbaut. Christophe Boesch vom Max Planck-Institut hat die Wild Chimpanzee Foundation aufgebaut. Mit seiner Arbeit konnte er an der Elfenbeinküste wunderbare Resultate erzielen und viele Populationen vor ihrem sicheren Untergang retten.
Dueblin: Herr Matthias Eckenstein, seines Zeichens Unternehmer und Mäzen, Interviewpartner von Xectuvies.net, hat vor kurzem rund 20 Mio. Franken für ein neues Affenhaus im Basler Zoo gespendet. Haben solche Projekte auch positive Auswirkungen auf Urwälder, wo die Populationen offenbar verschwinden?
Prof. Dr. Klaus Zuberbühler: Solche Unterstützungen sind enorm wichtig und sie tragen wesentlich zur Sensibilisierung der Menschen bei. Wir werden in Uganda zurzeit vom Zoo in Edinburgh unterstützt, ein wunderbares Engagement, mit dem viel zum Schutz der Primaten beigetragen werden konnte. Ich würde mir natürlich wünschen, dass Institutionen in der Schweiz ähnlich aktiv werden und auch vor Ort helfen, dort wo diese Tiere herkommen. Es ist relativ einfach, Geld für zeitlich begrenzte Projekte zu finden. Was viel schwieriger ist, ist die Finanzierung von Langzeit-Partnerschaften, die für den Artenschutz aber unabdinglich sind. Zoos sind diesbezüglich in einer besonders privilegierten Lage, da sie einen direkten Bezug zur Bevölkerung haben und diese über die Entwicklungen vor Ort direkt informieren können. Der Schutz der Primaten ist ein grosses Problem und oft denke ich, dass wir möglicherweise zur letzten Generation gehören, die diese Tiere noch im Freiland studieren können.
Ich selber wünsche mir weiterhin viel Offenheit für die vielen Geheimnisse, die unsere Artverwandten mit sich tragen. Ich wünsche mir weitere interessante Erkenntnisse und natürlich auch den direkten Kontakt mit den Primaten. In Bezug auf meine Vorlesungsverpflichtungen und die weiteren Aufgaben, die eine Arbeit an einer Universität mit sich bringen, wünsche ich mir eine gute Balance zwischen Praxis und Theorie.
Dueblin: Sehr geehrter Herr Professor Zuberbühler, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen und Ihren Forschungsprojekten alles Gute und weiterhin viel Erfolg!
(C) 2013 by Christian Dueblin. Alle Rechte vorbehalten. Anderweitige Publikationen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors gestattet.
______________________________
Links
– Universität Neuenburg