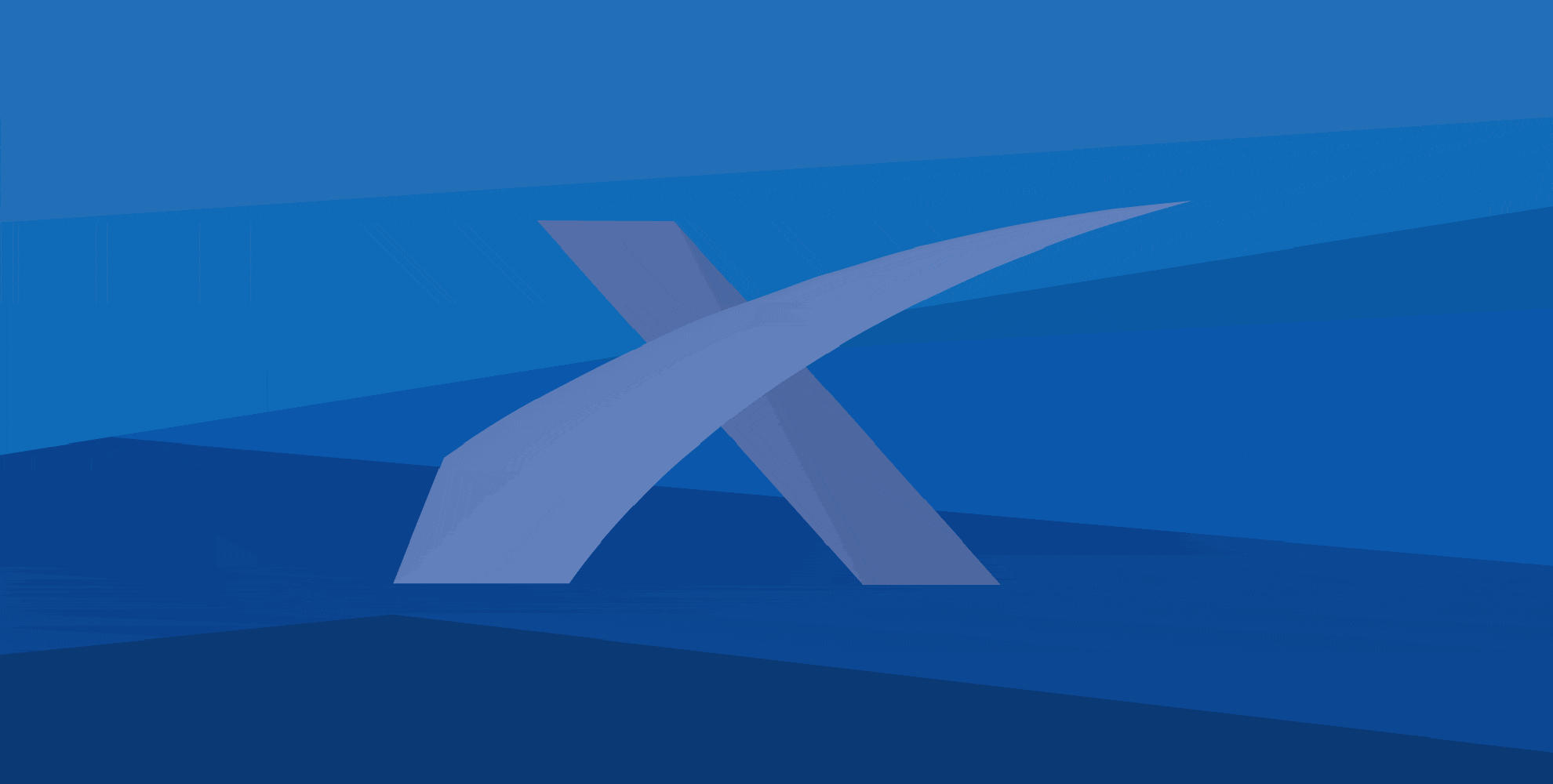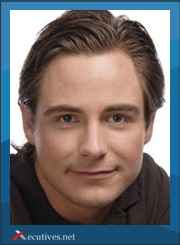
Jan Thomas Otte
Jan Thomas Otte, Jahrgang 1983, studierte Theologie an den Universitäten Princeton und Heidelberg. Nebst Studien der Psychologie und BWL berichtet er seit seinem 15. Lebensjahr als Journalist, darunter auch für die Neue Zürcher Zeitung. Live berichtete er aus New York vom Ausbruch der Wirtschaftskrise. 2009 war Otte für den Wirtschaftsethik-Preis der Genfer Finanzaufsicht nominiert mit dem Titel: Tugendhafte Unternehmen, Platz christlicher Ethik? Als Fellow an der Princeton University und dem Liechtenstein-Institut für Selbstbestimmung forscht Jan Thomas Otte zum Verhältnis von Management und Religion. Im Interview mit Christian Dueblin spricht er über Schnittstellen zwischen Theologie und Ökonomie. Der Autor berichtet über Managerinnen und Manager, die ihre Wertvorstellungen leben und pflegen. Viele Manager seien langfristig erfolgreicher und krisenfester, wenn sie im christlichen Glauben verankert seien, so Otte. Erfolg hänge auch von der eigenen Perspektive, dem Sinn des Ganzen ab.
Dueblin: Sehr geehrter Herr Otte, Sie waren während der Wirtschaftskrise in den USA. An der Princeton University haben Sie Wirtschaftsethik studiert und daneben auch für Medien in der Schweiz und Deutschland geschrieben. Was haben Sie ausserhalb der Elite-Hochschule in den USA beobachtet?
Jan Thomas Otte: Im Prinzip genau das, was wir auch im deutschsprachigen Raum beobachten. In den USA sind Manager häufig Symbolgestalten geworden, Heilsbringer oder Dämonen in einer globalisierten Wirtschaftsordnung. Die Firmenbosse stehen wie nie zuvor im Rampenlicht der Medien. Das ist natürlich auch ein Schleudersitz für die Karriere. Besonders kompetitive Unternehmen wie McKinsey oder Boston Consulting wetteifern auf Campus-Karrieremessen wie in St. Gallen um ihre besten Köpfe. Sie locken mit hohen Einstiegsgehältern und einer teils religiös anmutenden Wertegemeinschaft, frei nach dem Motto: „Hast du was, bist du was“. Kritiker nennen das auch die Ideologie der „Insecure Overachievers“. Jung und erfolgreich, aber ziemlich unsicher und manchmal eben auch depressiv.
Dueblin: Das Leben auf dem Campus einer Elite-Uni kennen viele nur aus Filmen oder Romanen. Harvard, Princeton und Yale decken meines Wissens jedoch nur einen Prozent des akademischen Bedarfs an Hochschulabgängerinnen und -abgängern der USA ab. Trotzdem liest und hört man hier fast nur von ihnen. Auf was ist das zurückzuführen?
Jan Thomas Otte: Besonders staatliche Provinz-Unis im mittleren Westen hoffen auf mehr Studierende, fortschrittliche Entdeckungen oder gar den ersten Nobelpreisträger aus eigenem Hause. Im letzten Shanghai-Ranking war in der Schweiz die ETH Zürich auf Platz 23 ziemlich weit oben, natürlich hinter Cambridge und Oxford in Europa. Die Uni Zürich folgt auf Platz 53 und Heidelberg auf Platz 63 der weltweit besten Unis. Princeton profitiert von diesem Ranking. Ein Motto kursiert auf dem Campus: „You learn, earn, and will give back“. Nicht jeder hält sich an diesen Deal der Verbundenheit. Begabte Studenten bekommen hauseigene Stipendien. 17 Milliarden US-Dollar Vermögen in eigener Stiftung fördern ihre „High Potentials“. Das System funktioniert seit 250 Jahren: „Die einen bringen das Geld, die anderen das intellektuelle Kapital“, meint die Präsidentin der Uni. Bei 7’500 Studenten stehen theoretisch für jeden rund zwei Millionen zur Verfügung. Die Zinsen werden meist in sicheren Anlagen gemanagt, gezockt und verloren wurde an der Börse aber dennoch viel.
Dueblin: Die finanziellen Verluste der Elite-Unis waren offenbar um ein Vielfaches höher als die Verluste anderer Hochschulen in den USA. Wie erklären Sie sich das?
Jan Thomas Otte: Die Princeton University hat ein Drittel ihres Vermögens verloren, bei Harvard war es sogar ein zweistelliger Milliardenbetrag. Bisher ging die Rechnung auf, weil viele Absolventen schon im dritten Jahr an der Wall Street ihre erste Million kassierten, frisches Geld in Alumni-Verbände spendeten und dieses Geld dann wiederum an der Wall Street angelegt wurde. Das war vor der Krise. Bei diesem Kreislauf der Hochschul-Finanzierung kam Hochmut sprichwörtlich vor dem Fall.
Dueblin: Was unterscheidet die USA Ihres Erachtens von Europa, insbesondere von Deutschland, wo Sie aufgewachsen sind? Sind es rund um die Krise die gleichen Fragen, die Ihnen in den USA, Deutschland und der Schweiz gestellt werden oder gibt es grundsätzliche Unterschiede?
Jan Thomas Otte: Die Diskussionen in Princeton, New York und Zürich sind ähnlich verlaufen. Doch die Mentalität in den USA ist eine andere als hier bei uns. Bevor Barack Obama ins Weisse Haus als Präsident einzog, sagte Medienstar John F. Kennedy bereits: „Schaue nicht zuerst, was Dein Land für dich tun kann, sondern sieh zu, was du für Dein Land tun kannst“. Diese Mentalität des Anpackens, nicht die des Jammerns, unterscheidet die USA und Europa meines Erachtens deutlich.
Dueblin: Ein grosser Unterschied scheint auch zu sein, dass viele Menschen in den USA in Bezug auf die Krise von einer „Strafe Gottes“ sprechen. Solche Aussagen gilt es in einem Land, in dem auch religiöser Fundamentalismus zu finden ist, genauer zu hinterfragen. Vor kurzem sagte der CEO von Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, der Sunday Times, dass er „Gottes Werk“ vollenden würde. Was steckt hinter dieser Auffassung?
Jan Thomas Otte: Die Medien haben viele Leserbriefe zu dieser Aussage bekommen. Ihre Gegenthese lautete, dass dieser Banker eher Gottes Werk vernichtet statt verrichtet. Sektenführer haben sich sogar in Welt-Untergangs-Prophetien versucht. Doch die Wirtschaftskrise in ihren Auswirkungen zu verteufeln nützt niemandem. Diese Auffassung von Blankfein zeigt aber, dass der Mensch als solcher, besonders aber auch Manager nach dem tieferen Sinn des Lebens zwischen Wettbewerb und Leistung suchen. Das klingt vielleicht etwas schwarz-weiss gemalt, plakativ oder polarisierend. Einige Freikirchen ziehen sogar einen unmittelbaren „Tun-Ergehen-Zusammenhang“ zwischen Gebetspraxis und Geldwirtschaft. Das Motto: „Wenn du betest, bist du auch wirtschaftlich erfolgreicher“ ist Nonsens. Im Kern jedoch steckt ein Funken Wahrheit. Kapitalismus kann zum Ersatz der Religion werden, indem das System funktionell Sorgenfreiheit verspricht.
Dueblin: Auf was beziehen Sie sich dabei, wenn sie Management und Glauben auf eine Ebene setzen? Zumindest leuchtet diese Parallele nicht auf den ersten Blick ein.
Jan Thomas Otte: Mit einem jüdischen Top-Manager habe ich mich an der Wall Street über die Geschichte vom goldenen Kalb unterhalten. Wir kamen zu folgendem Ergebnis: Der Job als Manager kann zum Götzen werden, die Spekulation an der Börse zum Gottesdienst, die Chefs der Banken werden zum Hohepriester. Der christliche Glaube versteht das genau andersrum. Seine Botschaft lädt Manager dazu ein, sich auf ein neues Bezugssystem für ihre Geschäfte einzulassen. Die Wirtschaft ist nur ein Teil dieses Priorisierens. Die von mir interviewten Manager tröstet es, dass Geld und Gewinn nicht absolute Grössen sind. Das Unterscheiden zwischen harten und weichen Faktoren, wo Gewinn-Maximierung meist an erster Stelle steht, halte ich für überholt. Im Management wird von anderen erwartet, dass man für jedes Problem eine griffige Lösung hat. Doch in der Wirtschaft wie im Glauben geht es immer wieder um den eigenen Umgang mit Unverfügbarkeit. Ein mangelhaftes Bezugssystem macht sich bemerkbar, wenn wieder masslose Boni sprudeln. Ich verstehe christlichen Glauben im Management nicht bloss als Randerscheinung, Diversity Management oder eine Art von Problem Solving. Es geht um die Existenz, das Ziel und die Strategie des Handels.

Jan Thomas Otte (c) Jan Thomas Otte
Dueblin: Was könnte ein ungläubiger Manager gegen seine Gier tun?
Jan Thomas Otte: Nur wenn ich die Wirtschaftskrise auch als Teil meiner eigenen Wirklichkeit verstehe, kann ich effektiv anderen etwas Gutes tun – zum Beispiel meine Gier nach schnellem Gewinn erkennen. Und sich dann von innen heraus ändern. Wissenschaftler nennen das gerne Reflexionskompetenz. Die bringt mehr als vom bequemen Sofasessel aus die bösen Banker zu beschimpfen. Die Kirche macht hier einen Unterschied, indem sie den Einzelnen hört. Die grosse Politik ist ihre Sache dagegen nicht. In Zürich wie New York bietet sie Seelsorge-Kurse für interessierte Führungskräfte an. Das hat nichts mit Moralismus zu tun. Es ist ökonomisch gesprochen die Bedarfsdeckung eines gestiegenen Bedürfnisses nach Halt und Orientierung, auch in den Chefetagen.
Dueblin: Sie haben Theologie, Psychologie und Ökonomie studiert. Die Frage nach religiösen Werten hat sich auch in Ihren Berichten niedergeschlagen. Was können der christliche Glaube, die Kirche in dieser Krise Ihres Erachtens zur Lösung der bestehenden Probleme beitragen?
Jan Thomas Otte: Professoren wie David Miller arbeiten in Princeton daran, dass christlichem Glauben in einem Casino-Kapitalismus wieder mehr Kredit geschenkt wird. Christen hatten die letzte Zeit wenig Einfluss auf die Wall Street. Jetzt ist das anders. Die Verankerung im christlichen Glauben kann endgültige Gewissheit, Hoffnung und Vertrauen schaffen. Die Gemeinschaft mit anderen Christen hilft dann auch beim Bewusstwerden eigner Defizite. Der kleinste gemeinsame Nenner lautet: Nächstenliebe. „Christsein“ ist nicht bloss eine Privatsache. Das „Christsein“ muss sich auch im Beruf ausdrücken. So lautete auch eine zentrale Einsicht der Reformation von Luther und Calvin. Dass Wirtschaft ihren Zweck nicht in sich selbst bestimmen kann, sondern sie um des Menschen willen da ist, lautet die soziale Botschaft.
Dueblin: Wie verstehen Sie das?
Jan Thomas Otte: Management und Religion teilen das Vertrauen in eine bessere Zukunft, haben Anreize des Belohnens und Bestrafens, betonen aber auch die Selbstbestimmung des Einzelnen. Manager sollten ihren religiösen Glauben und den ihrer Mitarbeiter und Kunden daher ernst nehmen. Beim Thema Gesundheit und dem Vereinbaren von Beruf und Familie ist das ja bereits der Fall. Und Pfarrer sollten Führungskräfte in der Wirtschaft nicht völlig aus den Augen verlieren. Da haben Kirchen noch etwas Nachholbedarf. Mit ihren Industriepfarrämtern, Diakonie oder Caritas sprechen sie traditionell eher Arbeitnehmer als Arbeitgeber an. In den USA ist das anders. Bei uns übernehmen diesen Part freikirchliche Organisationen, wie der Führungskräfte-Kongress von „Christen in der Wirtschaft“. Auf dem „Willow Creek Congress“ Ende Januar sprach übrigens auch der Management-Vordenker Fredmund Malik zum Thema Leadership: Führen, Leisten und Leben.
Dueblin: Was haben Ihres Erachtens die Diskussionen über Werte, Tugenden und Glauben in den letzten Monaten konkret verändert? Haben sie Bodenkontakt mit der Wirtschaft bekommen?
Jan Thomas Otte: Manager fühlen sich berufen, in Unternehmen „Karriere zu machen“. Bisher finden Christen unter ihnen aber noch wenige Möglichkeiten, ihre Prinzipien auch in der Geschäftswelt funktional erkennbar umzusetzen. Neben Rufen nach mehr Familienfreundlichkeit, der Vereinbarkeit von Kind und Karriere halte ich ein Modell glaubensfreundlichen Managements für zeitgemäss, das auch Spiritualität im weitesten Sinne zulässt. In den USA gehört das bereits zum Standard guter Unternehmensführung, zum Beispiel täglich 15 Minuten Zeit für einen Gebetspaziergang zu gestatten. Wer das nicht will, kann sich auch sozial in Projekten engagieren. Eine glaubensfreundliche Firma verändert Unternehmenskultur umfangreicher als meist angenommen. Sie schafft im Idealfall flachere Hierarchien und ein stabileres Betriebsklima. Und das ohne finanzielle Anreize. In den USA gibt es jede Menge Best-Practise Beispiele, wie sich christlicher Glaube auch nach 2000 Jahren positiv auf das Wirtschaften auswirken kann. Ethische Indikatoren dafür sind zum Beispiel ein fairer Lohn und die Anerkennung aller Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden.
Dueblin: Haben die von Ihnen interviewten Top-Manager Erkenntnisse gewonnen, ob Firmen, die mit moralischem Anspruch unterwegs sind, die Krise besser meistern als andere, die solchen Fragen keinen oder nur einen geringen Platz einräumen?
Jan Thomas Otte: Corporate Social Reponsibility (CSR) hat sich in der Wirtschaftskrise als Codewort, aber auch Selbstverständnis vieler Unternehmer entwickelt. CSR bleibt aber ein Lippenbekenntnis, solange entscheidende Vorbilder fehlen, die Unternehmenskultur und der Personal Fit „nicht passen“. Bei allem Streben nach Öffentlichkeit, das eigene Geschäft als besonders verantwortungsvoll zu vermarkten: CSR ist mehr als PR-Kür, um am Ende des Tages mehr Geld zu verdienen. Unternehmen haben eine moralische Verpflichtung, sich gegenüber ihren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten sozial zu verhalten. Langfristig wird dieses Erlösmodell auf dem Markt der Möglichkeiten überzeugen. In den ökonomischen Sachzwängen ist CSR also Werkzeug und Wertmassstab zugleich. Ist dieser Glaubenssatz nicht etwas zu naiv gedacht?
Man spricht in der Branche auch vom „Monster namens Milton“. Das ist der Titel einer Cartoon-Serie aus den USA. Der Ökonom Milton Friedman schrieb 1970 in der New York Times, es sei die einzige Verantwortung des Unternehmers, die Rendite des Shareholders zu erhöhen. Dieses Zitat, Moral müsste man sich leisten können, kann man heute leicht umkrempeln. Niemand kann es sich an der Wall Street noch leisten, auf Moral öffentlich zu verzichten. Allen sozialen oder spirituellen Interessen gerecht zu werden, ist als Mensch unmöglich. Daher bedarf es Managern und Mitarbeitern von mutigem Charakter, die ich zum Beispiel in den USA kennengelernt habe. Sie ziehen ihre Kraft aus Tugenden, glauben dass sie andere und sich selbst lieben können, weil Gott sie zuerst geliebt hat. Sie bekommen etwas, das sie aus eigener Kraft heraus nicht geben könnten. Dieses biblische Bekenntnis erschliesst sich in der säkularisierten Gesellschaft auf den zweiten Blick.
Dueblin: Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Jan Thomas Otte: Den Mut, sich nicht von scheinbar dominierenden Meinungen oder Miesmachern beherrschen zu lassen. Am meisten wünsche ich mir aber, ganz nah an meinem Inneren, meiner Identität, zu leben. Ich freue mich über die göttliche Gnade, die ich selbst im Glauben an Jesus Christus gefunden habe. Das hat wenig mit frommer Eitelkeit zu tun, sondern mit der Erkenntnis der eigenen Schwächen, die wiederum stark macht. Jeder muss das offenherzig für sich selbst herausfinden. Ich wünsche aber jedem, auch scheinbar unorthodoxe Wege zu gehen, die kurzfristig bedingt gewinnversprechend, langfristig aber weise sind.
Dueblin: Sehr geehrter Herr Otte, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg!
______________________________
Links
– Homepage
– Fachartikel im manager magazin: „Gutes Geld, Glaube, Gewissen“
– Kolumne in Perspektive Mittelstand: „Lebensfreude trotz Leistungsdruck“
– Erfahrungsbericht „Karriereschmiede, Wissensdurst und Efeuranken“
– Fachartikel in Welt Online: „Finanzkrise füllt die Kirchen an der Wallstreet“
– Mehr zum Thema Ethische Geldanlage in Jan Thomas Ottes Magazin „Karriere-Einsichten“
– Fachartikel „Risiko und Renditen ethischer Investments“