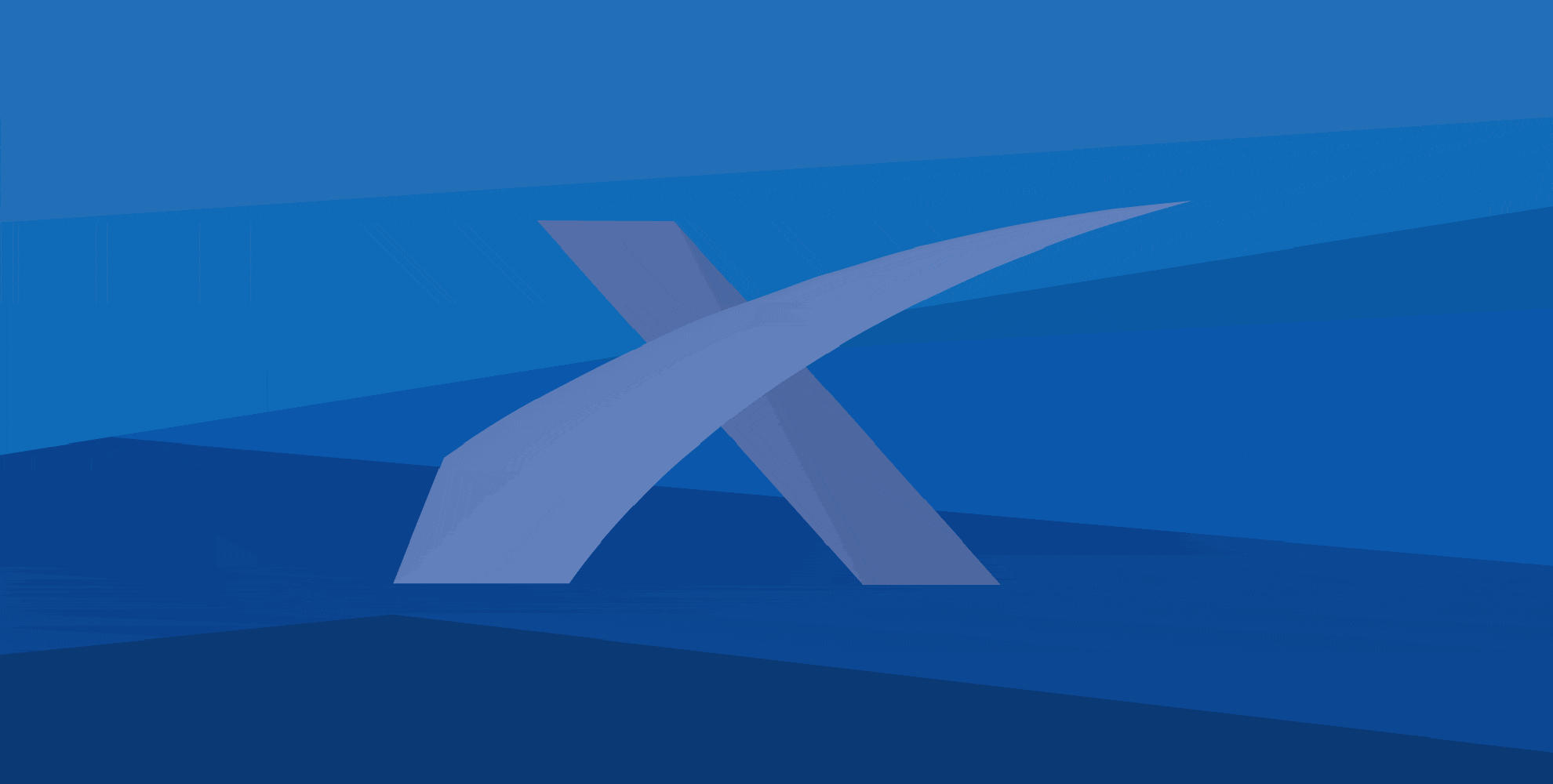Gilles Tschudi
Gilles Tschudi, Jahrgang 1957, wurde einer breiteren Öffentlichkeit aufgrund seiner Rolle als Michael Frick in der Fernseh-Soap Lüthi & Blanc bekannt. 2006 spielte er im Film Grounding – Die letzten Tage der Swissair den UBS-Banker Marcel Ospel. Gilles Tschudi wuchs in Basel auf und dürfte der einzige Schauspieler sein, der regelmässig sowohl in deutschschweizerischen als auch in welschen Produktionen mitwirkt und beide Kulturen bestens kennt. Sein schauspielerisches Werk umfasst TV-Produktionen, Kino-Filme, Kurzfilme, aber auch Musikvideos und sehr viel Bühnenarbeit. Lange Jahre war er an namhaften Schauspielhäusern tätig, auch als Regisseur, so auch in Zürich, Basel, Genf, Göttingen, Wuppertal und Köln. Seine Rolle als Goltz im Film Mein Name ist Bach, Johann Sebastian Bach (Regie: Dominique de Rivaz), an der Seite von Schauspielern wie Jürgen Vogel und Vadim Glowna, brachte ihm den Schweizer Filmpreis 2004 für die beste Nebenrolle ein. Im Interview mit Christian Dueblin spricht Gilles Tschudi über seinen schauspielerischen Werdegang, zeigt auf, wie er an Rollen wie Goltz oder den ehemaligen UBS-Banker Marcel Ospel herangeht und er erklärt, warum er den Röstigraben, den er aus seiner beruflichen Tätigkeit her kennt, in sich selber trägt. Gilles Tschudi erklärt zudem, warum er sich als Ehrengast für das von Giacun Caduff initiierte und organisierte Basler Gässli Film-Festival 2013 zur Verfügung gestellt hat, wo zahlreiche seiner Filme gezeigt wurden.
Dueblin: Herr Tschudi, Sie gehören zu den sehr bekannten Gesichtern, die wir von Filmen und Theaterbühnen her kennen. Wenn man Ihren Lebenslauf anschaut, sind Sie aber sehr spät zum Film und Kino gekommen und haben zuvor viele Jahre auf bedeutenden Bühnen gespielt. Wie erklärt sich der späte Eintritt in die Welt des Kinos und Films?
Gilles Tschudi: Ich bin zu einer Zeit zum Schauspielberuf gekommen, Mitte der Siebzigerjahre, als das Fernsehen und der Film noch nicht digital beherrscht waren, sondern noch mit Zelluloid gearbeitet wurde. Der Aufwand für Produktionen war damals viel grösser als das heute der Fall ist und es wurde entsprechend auch weniger produziert. Das Fernsehen hatte nicht den gleichen Stellenwert wie heute. Ich erinnere mich, dass damals Die Sieben Todsünden gedreht wurde, 7 Filme, die sich mit den Todsünden auseinandersetzten. Ich war damals in Wuppertal am Theater tätig, als ich für zwei dieser Filme angefragt wurde. Ich bekam vom Theater in Wuppertal auf meine Frage hin, ob man mir erlauben würde, in den Filmen mitzuspielen, die Antwort, dass ich mich entscheiden müsste – entweder Theater oder Film. Ich stand damals am Anfang meiner Karriere und es wäre sehr verlockend aber auch eine Todsünde gewesen, bei diesen Filmen mitzumachen. Ich entschied mich schliesslich für das Theater und bin heute sehr froh über diesen Entscheid von damals. Es ist wichtig, dass ein junger Schauspieler spielen kann und Zeit hat, eine Rolle zu entwickeln. Beim Fernsehen muss ein Schauspieler sehr schnell auf den Punkt kommen. Das sind zwei verschiedene Welten.
Ich stand zuerst in Zürich, später auch in Basel, in der Romandie und dann auch sehr viel in Deutschland auf der Bühne. Ein entscheidender Schritt für mich war meine Arbeit am Neumarkt Theater in Zürich. Ans Neumarkt Theater gehen zu können, war während der Schauspielerausbildung immer ein grosser Traum von mir. Die Jahre an diesem Theater stellen für mich eine wertvolle Zeit dar. Es ergab sich, dass Ende der Neunzigerjahre die Schweizer TV-Soap Lüthi & Blanc in Planung war. Für diese Fernseh-Soap arbeitete ich später rund acht Jahre. Danach war ich vor allem als freischaffender Schauspieler unterwegs.
Dueblin: Wie kamen Sie zur Schauspielerei und was hat Sie damals bewogen, ein doch erhebliches Risiko einzugehen? Immerhin schaffen es nicht viele Schauspieler, später von ihrem Beruf auch leben zu können.
Gilles Tschudi: Ich war sehr jung, als ich entschied, Schauspieler zu werden. Eine innere Stimme riet mir, den Weg als Schauspieler einzuschlagen. Meine Entscheide wirken für andere Menschen oft spontan und sie sind oft auch für mich überraschend, obwohl diese Entscheide in meinem Unterbewusstsein sicher lange in Bearbeitung waren. Meine Eltern haben mich zweisprachig erzogen. Meine Mutter kam aus der Romandie und mein Vater war Deutschschweizer. Ich war nicht wirklich an einem Ort zuhause. Mein Bruder, der sechs Jahre älter war als ich, hatte die Sprache in der Familie für sich eingenommen. Er war sehr sprachgewandt und konnte sich eloquent ausdrücken. Ich war mehr der Zuhörer und Beobachter, etwas schüchtern. Meine Eltern meinten, dass ich mit 12 Jahren schon geäussert habe, Schauspieler werden zu wollen. Ich hatte damals Der eingebildete Kranke von Molière mit meiner Mutter in Basel gesehen. Ich informierte mich, ob es in Basel eine Schule für Schauspielerei gab und wurde fündig. Ich ging dorthin und stellte mich vor. Die Schule fand, dass ich begabt sei. Natürlich war sie auch froh, wieder einen zahlenden Schüler zu haben.
Dueblin: Wie hatten Ihre Eltern damals auf diesen Entscheid reagiert?
Gilles Tschudi: Meine Eltern hatten sich sehr vorbildlich verhalten. Sie haben mich indirekt gefördert. Sie haben beobachtet, sahen aber davon ab, mir zu sagen, wie man etwas machen sollte. Sie haben mich immer unterstützt, auch wenn ich einmal nicht weiter wusste, was aber nur selten passiert ist in meinem Leben. Beide hatten auch sehr viel Geduld. Mein Vater sagte, er käme nicht aus diesem Metier und könne mir keine grossen Ratschläge erteilen. Beide hatten auch die Matura gemacht, viel gelesen und meine Mutter ging regelmässig ins Theater. Vom Schauspielfach war aber niemand.
Nach drei Monaten schon verliess ich die Basler Schauspielschule, wo ich auch Leni Anderfuhren und Colette Greder kennenlernte. Nach meinem Austritt aus der Schule in Basel bereitete ich mich mit Freunden auf das Vorsprechen an der Schauspielakademie in Zürich vor. Ich wurde aufgenommen und absolvierte die Schauspielakademie, die heutige Zürcher Hochschule der Künste, wo ich später auch dozierte.
Dueblin: Sie stammen aus der Familie, bei der Anna Göldin wohnte, die später als Hexe geköpft wurde. Von den Medien ist diese Verbindung aufgenommen worden, offenbar mit dem Ziel, das nachhaltig Böse zu untermalen, das Sie in vielen Rollen verkörpern.
Gilles Tschudi: Anna Göldin wohnte in Glarus bei einer Familie Tschudi. Es ist nicht klar, was alles passiert ist. Eine Version besagt – es gibt verschiedene Quellen -, dass Anna Göldin die Hausangestellte war im Haus der Tschudi. Herr Tschudi und Anna Göldin hatten ein Verhältnis, was seine Frau dazu brachte, Anna Göldin als Hexe zu denunzieren. Unter Druck von Frau Tschudi musste Herr Tschudi mit anderen Verantwortlichen den heute bekannten Hexen-Prozess gegen Anna Göldin durchführen, in dem Anna Göldin schliesslich geköpft wurde. Die Geschichte ist nicht wirklich schön. Die Vorgänge heute sind aber oft ähnlich. Wir kennen solche Racheakte aus den Medien und aus Romanen.
Die Medien hatten aufgrund von PR-Gründen natürlich Interesse an dieser Connection. Der „Bösewicht“ aus Lüthi & Blanc und aus Grounding – Die letzten Tage der Swissair und der eben erwähnte Herr Tschudi, der Anna Göldin als Hexe verfolgte, sollten tatsächlich das Böse und Fiese aufzeigen und einen Spannungsbogen zu meinen Rollen darstellen. Die Devise war wohl „Tschudi gleich Tschudi“ (lacht).
Dueblin: Sie erscheinen alles andere als böse, wenn man Sie persönlich kennt. Irgendwann aber wurde erkannt, dass man Sie als Bösewicht sehr gut einsetzen kann. Ist es nicht so, dass Schauspieler, die gewisse Rollen sehr gut spielen können, auch oft gewisse Charaktermerkmale dieser Rollen in sich tragen?
Gilles Tschudi: Doch, diese Feststellung ist natürlich absolut richtig. Das ist aber jedem Menschen eigen. Ich bin ein Mensch, der versucht, nicht zu werten. Ich versuche der Falle „Gut und Böse“ zu entgehen. Jeder Mensch kämpft in seinem Leben, oft mit Problemen, die er gar nicht im Griff hat. Jeder will irgendwie zurechtkommen. Für Aussenstehende ist das in der Beobachtung anderer Menschen sehr relativ. Einer empfindet etwas als schlecht und ein anderer, weil er einen anderen Lebenshintergrund hat, empfindet die gleiche Handlung als gut.
Dueblin: Wie gingen Sie an Rollen ran, wie Michael Frick in Lüthi & Blanc?
Gilles Tschudi: Michael Frick verkörperte ich 8 Jahre lang. Ich ging die Rolle nicht mit der Einstellung an, dass Michael Frick böse ist. Ich habe versucht zu verstehen, welchen Werdegang er hatte, worunter er litt und wie er auf Probleme reagierte. In der Soap ist alles auch etwas vereinfacht und überzeichnet. Tatsächlich ist es einerseits so, dass eine breite Masse von Zuschauern Frick als böse empfindet. Andererseits gibt es aber auch Menschen, die ihn geschätzt haben. Zum Spielen ist diese Rolle enorm interessant. Er war ein Aufdecker, hat provoziert und trieb auch Menschen in den Tod. Aber schauen Sie, wie wir heute Gut und Böse zu unterscheiden versuchen. Es werden Kriege im Namen Gottes geführt. Hier sind die Guten und dort die Bösen. Kratzt man aber an der Oberfläche, muss man immer wieder erkennen, dass es vielleicht doch ganz anders ist. Wir lesen von Giftgasangriffen in Syrien und wissen nicht, was genau passiert ist. Vielleicht hat jemand Giftgas eingesetzt, um die Sache dem anderen in die Schuhe schieben zu können. Diejenigen, die gut wirken, sind oft nicht diejenigen, die wirklich gut sind, auch im Film. Aber, um auf Ihre Frage zurückzukommen, es ist natürlich schon so, dass die Rolle auch ein Bestandteil von mir ist. Man kann ja als Schauspieler gar nichts anderes spielen, als das, was man selber ist. Ein Schauspieler kann nur sich selber sein und versuchen, facettenreich zu spielen.

Gilles Tschudi
Dueblin: Stört einen dieses Image des Bösen und Fiesen manchmal und kommt es vor, dass Sie gewisse Rollen nicht erhalten, weil Ihr Image im Weg steht?
Gilles Tschudi: Ich stelle fest, dass viele Menschen, auch Menschen, die mich persönlich kennen, erstaunt sind, über das, was ich spielen kann. Das kann zu Recht dazu führen, dass sich diese Menschen sagen, dass ich irgendwie so sein müsse und vorsichtig werden. Ich versuche, die Wertung in Frage zu stellen, auch mich selber nicht zu werten. Wenn andere Menschen mich werten, dann sehe ich darin mehr das Problem meines Gegenübers als mein eigenes.
Bei Rollenanfragen gibt es Herausforderungen. Das gehört aber zum Spiel. Vor einigen Jahren wurde ein Fernsehfilm gedreht. Es ging um einen Manager, der unter einem Burnout leidet und ein Mädchen trifft, das gerade einen Teddybär stehlen will. Er bezahlt dem Mädchen den Teddybären und bekommt die familiären Hintergründe des Mädchens mit. Er fühlt mit dem Mädchen mit, das sich irgendwo am gesellschaftlichen Rand bewegt, wie er selber als Manager mit Burnout-Symptomen auch. Er hilft ihr schliesslich, aus dem Heim zu flüchten und fährt mit ihr nach Italien, um ihren Vater zu besuchen. Das ist eine gute Geschichte, die mir sehr gefällt und ich hätte diese Rolle des Managers sehr gerne gespielt. Der Regisseur wollte mich damals mit dabei haben. Das Fernsehen aber intervenierte, weil man Angst hatte, dass durch mich, mit dem Image, von dem Sie gesprochen haben, Fragen wie etwa Missbrauch von Jugendlichen o.ä. aufkommen könnten. Das war eine interessante Erkenntnis.
Dueblin: Sie tragen zwei Kulturen in sich. Ihr Vater ist Deutschschweizer und Ihre Mutter kam aus der welschen Schweiz. Wie erklären Sie sich mit diesem kulturellen Hintergrund die Tatsache, dass Lüthi & Blanc in der Romandie kein Erfolg wurde?
Gilles Tschudi: Die beiden Fernsehsender im Welschland und in der Deutschschweiz stehen in einem Konkurrenzverhältnis. Es sind Menschen mit zwei verschiedenen Mentalitäten tätig, die aus zwei unterschiedlichen Kulturkreisen stammen und zusammen etwas machen sollten. Die Deutschschweizer sind bei Co-Produktionen mehr nach Deutschland ausgerichtet und die Welschen mehr nach Frankreich. .
Von Anfang an war geplant, dass die Folgen überall gezeigt werden. Das hat aber eben nicht funktioniert. Dazu kommt, dass man alles auf Deutsch gedreht hat und nur ganz wenige Menschen in der Romandie als Schauspieler bekannt waren. Der Sitz von der Firma Blanc wollte man in Saint Croix haben. Nun ist aber Saint Croix auch nicht unbedingt der Referenzort für alle Romands, sondern auch für diese etwas abseits auf dem Jura-Hochplateau gelegen.
Dueblin: Das ist der Röstigraben…
Gilles Tschudi: Absolut! Dieser Röstigraben ist absolut erkennbar. Ich arbeite selber in beiden Gebieten und bin möglicherweise der einzige Schweizer Schauspieler, der regelmässig ohne sprachliche Probleme in beiden Welten arbeitet und dort zurechtkommt, also am Stadttheater Basel und in Zürich, aber auch beispielsweise am Grand Théâtre in Genf spielt oder gespielt hat. Was ich im Welschland oder auch in Frankreich mache, findet in der Deutschschweiz kein Interesse. Die Menschen hier haben davon keine Kenntniss und so steht es jedoch auch umgekehrt. Ich mache aber in beiden Welten sehr interessante Arbeiten.
Dueblin: Wo erkennen Sie diesen Röstigraben in Ihrer Arbeit und in Ihren Umfeldern, in denen Sie sich bewegen?
Gilles Tschudi: Ich bin der Röstigraben in Person! (Lacht) Ich trage diesen in mir drin und erlebe ihn jeden Tag. Meine beruflichen Freundeskreise in der Romandie und in der Deutschschweiz kennen sich nicht. Das führt im Grunde genommen zu einer doppelten Persönlichkeit. Es gibt gewisse Sachen, die man nicht teilen kann. Erkläre ich in der Romandie meinen Freunden, mit wem ich beispielsweise in Deutschland zusammenarbeite, so haben diese Menschen in der Regel keine Ahnung, von was ich spreche und auch umgekehrt ist das so. Ich könnte meinen Freunden erklären, dass ich in Afrika auf Suaheli arbeite und das wäre für beide Freundeskreise wohl etwa ähnlich exotisch (lacht). Das im gleichen Land! Das ist doch sehr erstaunlich.
Dueblin: Mein Name ist Bach ist ein Film, in dem Sie, neben Schauspielern wie Jochen Vogel, Karoline Herfurth oder Vadim Glowna mitgewirkt haben. All drei dürfen als Superstars bezeichnet werden. Glowna starb 2012. In der Sparte Nebenrolle erhielten Sie im Jahr 2004 für die Rolle des Goltz in dieser Produktion den Schweizer Filmpreis. Wie haben Sie die Dreharbeiten dieses sehr spannend gemachten Films, der auch am Basler Gässli Film Festival gezeigt wurde, in Erinnerung?
Gilles Tschudi: Ich habe eben mit Juliette Binoche und Kristen Stewart gedreht. Das war sehr interessant. Binoche hat eine sehr gute Ausstrahlung, eine spezielle Aura, die die Oscar-Preisträgerin umgibt. Auch Kristen Stewart ist spannend. Sie sind aber nicht anders, einmal abgesehen davon, dass sie in den Medien sehr präsent sind und oft noch zwei Bodyguards dabei haben. Sie sind aber nicht begabter, als Schauspieler, die ich in der Schweiz treffe. Der Film heisst Sils Maria. Ich spiele im Film den Zürcher Stadtpräsidenten. Gedreht wurde in Deutschland und es ist möglich, dass der Film nächstes Jahr auf der Piazza in Locarno gezeigt wird. Wir werden sehen.
Auch Jochen Vogel ist sehr bekannt und sehr sympathisch. Ich würde ihn als „Intuitions-Bolzen“ bezeichnen. Schüler von Vivianne Westwood hatten für den Film diese wunderbaren Kostüme gemacht. Die Kulissen waren gewaltig und sehr aufwändig. Für die Kleider wurden die besten Stoffe benutzt. Dominique de Rivaz wollte mit uns proben und Jürgen Vogel wollte wissen, was die Regisseurin nun genau machen wollte. Es war interessant zu sehen, wie Filmschauspieler und Theaterschauspieler anders an solche Projekte herangehen. Der Theaterschauspieler ist es sich absolut gewohnt zu proben. Jürgen Vogel’s Verhalten ist auch durchaus berechtigt. Er wollte seine „Jungfräulichkeit“ auf dem Set nicht verlieren. Im Grunde genommen ist der Filmschauspieler nicht jemand, der wiederholen kann. Der Theaterschauspieler erlebt regelmässig, dass am ersten Tag seine Rolle eine gewisse Frische hat und sich eine Entdeckerlust einstellt. Einen Tag später jedoch kann es sein, dass man die Rolle wieder spielt und sich Ernüchterung einstellt. Es stimmt für den Theaterschauspieler plötzlich nicht mehr. Was gestern gut war, ist heute anders. Das sind sehr schwierige Prozesse. Der Schauspieler schöpft aus dem Unterbewussten, das er hervorholt und etwas Bewusstes daraus macht, damit es wieder unbewusst werden kann. Das ist oft ein schmerzlicher Prozess.
Dueblin: Das war für Rivaz auch nicht einfach.
Gilles Tschudi: Die Zusammenarbeit war enorm spannend. Rivaz hat den Schauspielern sehr viel zugestanden und ihnen viel Vertrauen geschenkt. Meine Rolle war auf dem Blatt nicht sehr präsent. Sie hat nicht viel Text. Sie gab aber die Möglichkeit, im Stillen und Stummen spielen zu können. Die Rolle war eine grosse Herausforderung. Rollen, die im Geschehen nicht wirklich im Fokus sind, sind oft viel schwieriger, als Hauptrollen. Eine Lead-Figur steuert mit einer Geschichte einem Ziel entgegen, das der Zuschauer verfolgt. Der Schauspieler wird von der Geschichte getragen. Ist das nicht so, muss man eine Rolle, damit sie eine Daseinsberechtigung erhält, entdecken und erspielen. Hier zeigt es sich, ob ein Schauspieler gut ist oder nicht.
In Tandoori Love war das ganz ähnlich. Ich spielte im Film einen Schweizer Produzenten und immer wieder war ich in Szenen drin. Er begleitet Bollywood-Produzenten und das ganze Team in der Schweiz. Er muss eine Berechtigung erhalten, im Film zu erscheinen. Auch das war eine grosse Herausforderung. In beiden Fällen ging es darum, die feinstofflichen Bereiche zu beleben. Ich denke, das ist das Geheimnis des guten oder auch schlechten Schauspielers. Auch bei Marcel Ospel war das ganze Nonverbale eine grosse Herausforderung. Die Rolle hat im Film nicht viel Text. Es handelte sich um einen langen Auseinandersetzungsprozess mit ihm und zum Glück hatte ich Zeit für diesen Prozess.
Dueblin: Haben Sie Herrn Marcel Ospel jemals getroffen?
Gilles Tschudi: Ja, aber, das Treffen war von seiner Seite her betrachtet unfreiwillig und von meiner Seite her betrachtet notwendig. Ich traf ihn an der Basler Fasnacht. Wir wissen, dass er an der Fasnacht sehr aktiv ist. Am Telefon sagte mir Herr Ospel, dass die Produktion nichts mit ihm zu tun habe und er mit der Produktion nichts zu tun haben wolle. Er hat auch den Produzenten und Regisseur nicht getroffen. Das galt es zu respektieren. Für mich war es aber sehr wichtig, seine Aura zu erkennen, diese aufsaugen zu können. Es ging mir darum, die energetische Kraft, die von ihm ausgeht, zu erkennen. Ich wartete an der Fasnacht im Restaurant Schnabel auf ihn. Als er auftauchte, setzte ich mich zu ihm und begrüsste ihn. Er sagte mir damals genau zwei Sätze: „Der Herr Tschudi!“ und „Ich wünsche Ihnen eine schöne Fasnacht.“ Es steckt vielleicht ein kleines „vampirisches“ Verhalten darin, aber es ist mir doch gelungen, seine Aura erfassen zu können. Ich sagte später immer in Interviews über den Film, dass ich ihn gerne treffen würde, um ihm den „Ospel“ zurückzugeben. Dazu ist es aber bis heute nicht gekommen.
Dueblin: Was für ein Bild von Herrn Ospel hat die Auseinandersetzung mit ihm vor und während den Dreharbeiten für Sie persönlich ergeben?
Gilles Tschudi: Es ist ein spannender Prozess, wenn man sich mit einer solchen Rolle und einer solchen Person auseinandersetzt und ich lernte ihn auch auf irgendeine Art als Mensch lieben. Sein Verhalten, sein Unvermögen ist für mich liebenswert. Ich habe nie auch nur eine Sekunde gedacht, er wäre ein Unmensch. Es handelt sich um einen Menschen, der aus bescheidenen Verhältnissen kommt und sich mit seiner persönlichen Intelligenz bis ganz nach oben gearbeitet hat. Er hatte auch seine Sehnsüchte, so wie alle anderen Menschen diese auch haben. Wir sehen heute, wie schwer es für diese Manager oft sein kann. Es hätte auch alles ganz anders kommen können und irgendwann stellt man fest, dass man nur ein Spielball grösserer Zusammenhänge ist und vielleicht auch als Galionsfigur missbraucht wird. Man hat mich nach dem Grounding der UBS interviewt und mich gefragt, was ich von der Sache halten würde. Ich sagte damals, dass es doch sehr fragwürdig sei, wie man nun mit Herrn Ospel umgehe, nachdem jahrelang die ganze Schweizer Bevölkerung enorm profitiert habe. Immerhin sind Gelder in die Schweiz geflossen. Aber ist es denn nicht naiv zu glauben, dass man über Jahre hinweg Milliarden und Abermilliarden generieren kann und das ganze Geld auf ehrlichem Weg erschaffen wurde?! Das ist nicht wie Äpfel, die am Baum wachsen und in einem guten Jahr hat es mehr und in einem schlechten Jahr weniger. Wo mehr Geld ist, fliesst irgendwo auch Geld ab. Diese Stigmatisierung von Ospel hat mir auf alle Fälle missfallen. Ich selber gehe mehr davon aus, dass wir uns über eine Kollektivschuld Gedanken machen müssten.
Dueblin: Sie haben für das vom Filmemacher Giacun Caduff organisierte Basler Gässli Film Festival zugesagt, an dem viele Kurzfilme angeschaut werden können. Was war der Grund, als Ehrengast teilzunehmen?
Gilles Tschudi: Es ist sicher die Tatsache, dass das Festival in Basel stattfindet. Ich fühle mich mit Basel sehr verbunden. Viele Sachen hier erinnern mich an meine Kindheit. Wenn in Basel etwas stattfindet und ich Zeit habe, dann mache ich mit. Ein Lehrer sagte mir einmal, dass ich viel von älteren Schauspielen lernen werde und ich genau darauf achten solle, wie sie arbeiten. Das war absolut richtig. Jüngere Schauspieler schauen zu und beobachten, auch ohne, dass man sich ihnen aufzwingt. Es ist auch hier so, dass man Einfluss hat auf jüngere Menschen, indem man einfach so ist, wie man ist und nicht dadurch, wie man redet oder ihnen etwas sagt. Ich bin auch sehr dankbar, mit jüngeren Menschen zusammenarbeiten zu können. Sie geben Energie! Ich stelle das immer wieder fest, wie in der Auseinandersetzung mit Jungen grosse Energien fliessen, für die ich sehr dankbar bin. Das ist der Grund, warum bei Anfragen von jungen Menschen das Portemonnaie nicht an erster Stelle steht und ich oft zusage, wenn ich gefragt werde. Ein Schauspieler, der arbeitet und sich für seinen Beruf einsetzt, kann in solchen Auseinandersetzungen mit Jungen, aber auch in Workshops oder bei Interviews, die zum Beruf dazugehören, gut reflektieren. Es handelt sich um verschiedene Formen von Reflexion, was ich dankbar annehme.
Dueblin: Sehr geehrter Herr Tschudi, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch uns wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg!
(C) 2013 by Christian Dueblin. Alle Rechte vorbehalten. Anderweitige Publikationen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors gestattet.
______________________________
Links
– Homepage
– Wikipedia
– Spielfilm „Meine Name ist Bach“
– Das Gässli Film Festival