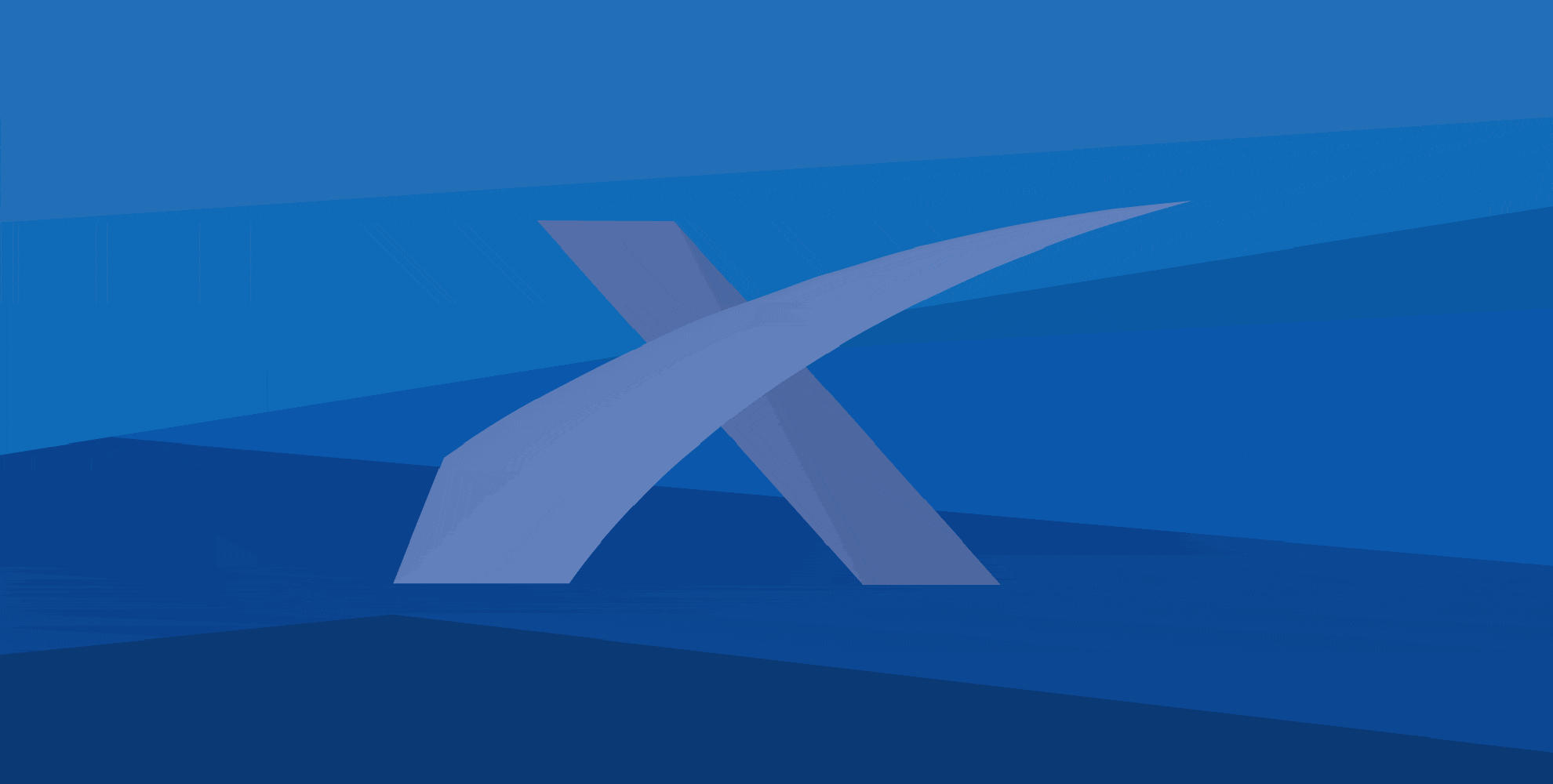Emil Steinberger
Emil Steinberger, geboren 1933 in Luzern, ist der wohl bekannteste Kabarettist in der Schweiz und in Deutschland. Mit Nummern wie „Polizeihauptwache“, „Der Kinderwagen“ und „Der Feinschmecker“ eroberte er die Herzen ganzer Generationen von Zuschauern, auch in der welschen Schweiz und in Frankreich. Mit dem Film „Die Schweizermacher“ von Rolf Lyssy feierte er 1978 einen grossen internationalen Erfolg als Schauspieler. Der Einbürgerungsbeamte an der Seite von Walo Lüönd ging in die Film-Geschichte ein. Nach Jahrzehnten Kabarett- und Kleinkunstarbeit sowie zwei Abstechern in die Zirkuswelt zog sich Emil Steinberger im Jahre 1987 von der Bühne zurück, widmete sich einige Zeit der Werbung und reiste 1993 nach New York, wo er bis 1999 zurückgezogen lebte und seine Frau Niccel heiratete. Im Gespräch mit Christian Dueblin erzählt Emil Steinberger von seinem Leben, seinem Werdegang, seiner Arbeit als Unternehmer und Künstler, seinem inneren Antrieb, der Leidenschaft und seinem Wunsch für die Schweiz für mehr Mut und Engagement für die Kleinkunst.
Dueblin: Sehr geehrter Herr Steinberger, es freut mich, Ihnen einen schönen Gruss von Herrn Prof. Dr. Gottfried Schatz, unserem letzten Interviewpartner, ausrichten zu können. Er meinte augenzwinkernd, der Film „Die Schweizermacher“ habe ihm die Integration in der Schweiz wesentlich erleichtert.
Emil Steinberger: (Lacht) Das freut mich zu hören. Schon habe ich gemeint, Sie würden nun sagen, der Film habe ihm das Leben in der Schweiz erschwert. Kürzlich habe ich nämlich gelesen, dass aufgrund des Films während 25 Jahren viel weniger Deutsche in die Schweiz gekommen seien. Sie hatten anscheinend grosse Angst, die „eidgenössische“ Prüfung abzulegen, die im Film eingehend beschrieben wird. Möglicherweise hat diese Menschen auch das Fondue-Kochen abgeschreckt. Mir kommt das vor wie die Fahrprüfung. Man versucht immer, die Sache etwas rauszuschieben. So erging es möglicherweise den betroffenen Deutschen, die gerne in die Schweiz gekommen wären.
Dueblin: Mit dem Film „Die Schweizermacher“ haben Sie unter anderem ein politisches Thema behandelt, das nach wie vor sehr aktuell ist. Es fällt aber auf, dass Sie mit Ihrer Arbeit als Kabarettist politisch sehr zurückhaltend sind und sich nicht, wie viele Ihrer Kollegen, über aktuelle Herausforderungen und Probleme äussern. Auch in Ihrem Buch „Emil via New York“ sind Sie sehr zurückhaltend, obwohl es auch dort sicher viel Politisches zu schreiben gegeben hätte. Machen Sie das absichtlich oder messen Sie der Politik einen weniger grossen Stellenwert ein als andere Kabarettisten?
Emil Steinberger: Ich finde, es braucht eine andere Wissensbasis, wenn man beispielsweise über Amerikas Politik schreiben wollte. Das wäre wohl eher etwas oberflächlich, wenn ich meinen Standpunkt schildern würde. Wenn ich auch auf der Bühne nicht „politisch“ tätig bin, bin ich doch als Mensch Emil Steinberger sehr politisch interessiert. Ich verfolge, was in der Schweiz und in Europa passiert, und habe auch in New York das politische Geschehen beobachtet und erlebt. Oft habe ich zu meiner Frau gesagt, dass wir vor einem wahnsinnig verrückten Welttheater stehen würden. Es ist oft spannender als im Theater, was zurzeit in unserer Gesellschaft alles passiert. Als ich vor vielen Jahrzehnten mit meiner Karriere in Luzern begann, habe ich nicht selten Widerstand gespürt, auch auf der politischen Ebene. Es fiel mir auf, wie schwer es war, mit seinen eigenen Ideen durchzudringen. Vielen Menschen fehlte das Verständnis, sei es für meine Arbeit oder sei es für die Kultur im Generellen. Das hat mich sehr geprägt und nachdenklich gemacht. Ich war somit gezwungen, nicht nur unternehmerisch, sondern auch politisch zu denken, um die Menschen und ihr Verhalten gegenüber meinen Projekten, Ideen und Visionen zu verstehen. Ich bin also kein unbescholtenes politisches Blatt.
Sie haben aber schon richtig beobachtet. Gegen aussen und bei meiner Arbeit als Kabarettist bin ich eher zurückhaltend mit politischen Positionen. Das hat aber vor allem damit zu tun, dass sich meine Bühnenprogramme nur schlecht mit Politik mischen lassen. Ich arbeite mit Figuren, welche normale, durchschnittliche, jedem auf dieser Welt bekannte Menschen darstellen, und zeige deren alltäglichen Schwächen und Freuden. Ich habe bewusst davon abgesehen, diese Menschen und ihre Situationen mit harten politischen Fakten und Auseinandersetzungen zu mischen. Ich bin der Meinung, dass es auch nicht gehen würde. Entweder ist man ein absolut politischer Kabarettist oder man befasst sich mit kulturellen und „gesellschaftpolitischen“ Themen. Ich bin aber in meiner Karriere oft in Versuchung geraten und überlegte mir verschiedentlich, was man mit diversen politischen, aber auch wirtschaftlichen Themen alles kabarettistisch machen könnte. Es ist doch wahnsinnig, was um uns alles abläuft. Man könnte aus dem Vollen schöpfen und unglaubliche Programme schreiben. Kabarettisten jedoch, die sich politischen Themen annehmen, müssen ihre Programme ständig korrigieren, neue Texte schreiben und stets absolut auf dem Laufenden sein. Das ist mit sehr viel Arbeit und Engagement verbunden. Meine Programme hingegen lassen es zu, dass man mit ihnen zwei bis drei Jahre durch die Welt ziehen kann. Wenn Sie so wollen, steckt auch etwas Bequemlichkeit hinter diesem Entscheid.
Ich muss nun noch hinzufügen, dass man auf der Bühne nicht einfach nur mit politischen harten Facts hantieren kann. Diese Fakten und Tatsachen müssen ganz subtil in eine gewisse humoristische und kabarettistische Form gebracht werden, so dass man darüber lachen kann. Die Menschen würden ansonsten die Programme nicht sehen wollen. Es ist paradox, dass man sich mit den traurigsten Themen und Problemen auf der Welt nur lachend auseinandersetzen kann.
Dueblin: Der Musiker und Kabarettist Art Paul Huber meinte vor kurzem, dass sich ein Wandel vom Kabarett hin zur Comedy vollzogen habe und damit oft auch die Qualität der Unterhaltung gesunken sei. Wie beurteilen Sie das Verhältnis zwischen wirklichem Kabarett, wie Sie es jahrzehntelang betrieben haben, und Comedy, die heute am TV angeboten wird?
Emil Steinberger: Ich sehe das auch so wie Art Paul. Diese neue Comedy-Welle ist bei uns angelangt. Vielleicht ist sie dadurch entstanden, dass es uns allen relativ gut geht. Auch die jungen Leute haben heute alles. Sie können sich einen Computer, Ferien und ein Auto leisten. Das ist fast schon ein paradiesischer Zustand, in dem wir in der Schweiz leben. Das führt natürlich dazu, dass man sich nicht mit gewissen Problemen auseinandersetzen muss und damit auch, mangels Nachfrage beim Publikum, weniger politische Themen und mehr Unterhaltung auf die Bühne gebracht werden. Diese „Unterhaltung“ kann man unterteilen. Comedy ist eine Welle, die von den USA auf Europa übergeschwappt ist, und wir haben sie hier, zur Freude der einen und zum Ärger der anderen, mit Handkuss entgegengenommen. Es ist ein einfaches Rezept, man steht auf der Bühne und erzählt von seinem Leben und seiner Familie und geht ab und zu auch unter die Gürtellinie. Gewissen Menschen gefällt das. Andere haben damit eher Mühe. Ich denke, dass wir diese Form des Humors und der Unterhaltung noch eine gewisse Zeit haben werden und sie irgendwann wieder durch etwas Neues ersetzt wird. Man kann nicht ewig mit den gleichen oberflächlichen Sprüchen arbeiten.
Die Comedy-Welle ist aber nicht nur so stark, weil sie anscheinend viele Menschen wirklich haben möchten. Diese Welle wird von gewissen Fernsehsendern enorm gefördert. Deren Ziel ist es, die Einschaltquoten hoch zu halten. Es gibt aber, das darf ich zur Beruhigung sagen, nach wie vor, gerade auch in Deutschland und der Schweiz, wunderbare Kabarettistinnen und Kabarettisten. Ich denke an Erwin Pelzig, Bruno Jonas, Gerhard Polt, Urban Priol, Matthias Richling, Joachim Rittmeyer, Simon Enzler, Andreas Thiel um nur einige herausragende Personen aus der Welt des Kabaretts zu nennen. Daneben gibt es Kabarettisten, die weniger bekannt sind, aber ebenfalls einen sehr guten Job machen. Das sollte man nicht vergessen. Das bedeutet auch, dass es immer noch Menschen gibt, die gutes Kabarett zu schätzen wissen.
Dueblin: Wie erklären Sie sich Ihren eigenen Erfolg mit Emil weit über die Grenzen der Schweiz hinaus?
Emil Steinberger: Ich habe als Emil Unterhaltungskabarett betrieben, vermischt mit Menschlichkeit, mit Charakteren- sowie Szenenschilderungen, die jeder auf die eine oder andere Art und Weise schon persönlich erfahren hat, nachfühlen kann und in sich trägt. Sobald ein Wiedererkennungseffekt da ist und ein Zuschauer etwas sieht, was ihm grundsätzlich vertraut ist, ist der positive Effekt oft so gross, dass ein Sketch oder ein ganzes Programm erfolgreich wird. Das geht fast automatisch, funktioniert aber nur, solange man nicht über die Köpfe der Menschen hinausspielt. Ich glaube, es ist mir immer gelungen, die gute Mischung hinzubekommen. Ich habe stets versucht, das Herz und den Bauch der Menschen zu erreichen. Das haben die Zuschauer gespürt und über Jahrzehnte sehr geschätzt, wofür ich sehr dankbar bin.

Emil Steinberger © Niccel Steinberger
Dueblin: Sie sind nicht nur Schauspieler und Kabarettist. Sie sind auch ein versierter und vielseitiger Geschäftsmann und Unternehmer. Wie sehen Sie sich selber in diesen Rollen?
Emil Steinberger: Ich glaube, dass tief in meinem Inneren etwas existiert, das dem Geschäftemachen gegenüber sehr positiv eingestellt ist. Sie haben das Wort „Geschäftsmann“ benutzt. Der Ausdruck gefällt mir. Ich kann mich erinnern, dass ich schon während meiner Zeit, als ich noch für die Schweizerische Post arbeitete, meinen Kolleginnen und Kollegen beispielsweise Schallplatten verkaufte, die ich aus Deutschland eingeführt hatte. Ich spreche von kleinen Mengen, vielleicht 10 oder 15 Stück…
Dueblin: …Ich hoffe, dass wir nun kein Strafverfahren wegen Schmuggels oder unerlaubten Handelns während der Arbeitszeit provozieren…
Emil Steinberger: (Lacht) Nein, so schlimm war das natürlich nicht, und meine „unerlaubten Handlungen“ wären heute auch verjährt! Das wär’s noch, wenn ich nach Publikation des Interviews noch Nachfragen vom Steueramt bekommen würde…
Aber zurück zu Ihrer Frage. Ich habe immer gespürt, dass mir das Geschäftemachen liegt. Es ist wie bei einem Spezereihändler, der stets an ausgewählten Orten etwas einkauft, wieder verkauft und sich dabei den Gewinn ausrechnet. Das Auswählen, Kaufen und Verkaufen war wie ein Motor für meine Tätigkeiten. Hauptmotivation war immer das kulturelle Element in meiner Arbeit. So stellte ich vor über 50 Jahren in Luzern fest, dass es in dieser Stadt kein richtiges Theater gab, das es den grossen Künstlern der Schweiz ermöglicht hätte, ihre Programme auch in Luzern zu zeigen. Das hat mich gestört, und ich wollte das ändern. Ich fing an, Keller und andere Räume auf ihre Theatertauglichkeit hin zu examinieren, in der Hoffnung, etwas Passendes zu finden. Ich hatte diese Idee im Kopf und wollte diese Idee auf alle Fälle umsetzen. Viele Menschen, denen ich von meinen Ideen erzählte, versuchten mir sie auszureden. Es gab Menschen, die sagten, dies und jenes sei unmöglich oder würde nichts bringen. Das Verhalten vieler Menschen meinen Ideen und Visionen gegenüber betrachte ich heute als grosse Lebensschule. Man muss von dem, was man macht, absolut überzeugt sein und leidenschaftlich arbeiten, nur so kann man durchhalten. Ich hatte mir damals angewöhnt, meine Ideen und Visionen nur wenigen Menschen zu erzählen.
Über lange Zeit hinweg musste ich mit sehr wenig Geld zurechtkommen. Ich liess mir von der Post mein Pensionskassenguthaben, das sich über die Jahre angesammelt hatte, ausbezahlen und wusste, dass dieses Geld einige Jahre ausreichen musste. Meine Mutter kaufte mir damals hin und wieder ein, so dass ich genügend zu essen hatte. Ich erzähle das, weil man solche Momente nur dann überstehen kann, wenn man von dem, was man macht, absolut überzeugt und beseelt ist. Dieses „Beseelt-Sein“ war neben dem Geschäftemachen mein zweiter Motor. Es war immer mein Wunsch, Menschen leidenschaftlich zu unterhalten und ihnen etwas zu bieten. Als ich noch im Kino-Geschäft war, habe ich in Luzern immer versucht, die besten Filme zu bieten. Im Theater wollte ich immer das Optimalste für die Zuschauer bieten. Genauso machte ich das aber auch, als ich noch als Grafiker mit einem eigenen Büro arbeitete.
Dueblin: Gerade in Ihrer Anfangszeit lief nicht immer alles rund und Sie mussten sich oft durchsetzen. Wie gingen Sie mit den Menschen und Institutionen um, die Ihre Visionen und Ideen damals, als Sie noch nicht so bekannt waren, nicht verstanden und Sie nicht unterstützen? Wie denken Sie heute darüber?
Emil Steinberger: Die meisten von diesen Menschen leben nicht mehr, und ich kann ihnen heute nicht mehr begegnen. Meine grösste Auseinandersetzung im kulturellen Bereich hatte ich damals mit der Stadt Luzern. Die Stadt tat sich anfänglich sehr schwer, meine kulturelle Arbeit zu unterstützen. Ich hatte das Kleintheater in Luzern schon fünf Jahre geführt, als ich von der Stadt Luzern 1’000 Franken bekam. Nach 10 Jahren teilte mir das Steueramt mit, dass ich alle Einnahmen an der Kasse des Theaters als Privateinkommen versteuern müsste. Man hatte damals nicht verstanden, dass das Kleintheater eine wichtige kulturelle Institution war. Junge Menschen liessen sich bei uns inspirieren und animieren. Das ging vom Kabarett bis hin zur Musik oder Literatur. Viele Menschen gingen nach den Vorstellungen nach Hause und packten selber ein Projekt an. Ich kann die Bedeutung solcher Tätigkeiten in einer Gesellschaft deshalb nicht oft genug wiederholen. Es ist enorm wichtig, dass man den jungen Menschen heute Dinge auf den Weg gibt, die sie das ganze Leben begleiten. Menschen, die beispielsweise musizierten, gehörten deshalb für mich schon damals zu den „Geretteten“. Sie kamen in der Regel nicht mit Drogen und Kriminalität in Kontakt. Musizieren und schauspielern kann auch eine Droge sein, sie ist aber nicht lebensgefährlich, führt nicht ins Elend und kann den Körper nicht kaputt machen.
Dueblin: Was hat Sie im Innersten motiviert, Ihre Karriere als Kabarettist über Jahrzehnte zu verfolgen und Menschen zu unterhalten?
Emil Steinberger: (Schmunzelt und überlegt lange) Das ist jetzt eine Frage, die ich wohl das erste Mal in meinem Leben in einem Interview richtig beantworten muss. Es war manchmal wie verhext damals, als ich noch Postbeamter war. Das Theaterspielen hatte mich fasziniert. Zur Zeit als ich mein eigenes Grafikatelier hatte, fand ich, dass es in Luzern ein Kleintheater brauchte. Gleichzeitig war ich damals schon in einem Ensemble als Schauspieler und Kabarettist tätig. Später fing ich an, alleine Kabarett zu machen und arbeitete an meinen Soloprogrammen. Als ich das Kleintheater führte, fragte man mich, ob ich zusätzlich ein Kino führen wollte. Theater und Kino passten irgendwie zusammen, dachte ich, und widmete mich somit auch dem Kino-Geschäft. Der Film interessierte mich schon immer. Als ich noch bei der Post war und in meiner Dachzimmerwohnung logierte, hatte ich immer alles, was mit Film oder Hörspielen zu tun hatte, aus Zeitungen und Zeitschriften ausgeschnitten. Diese Themen faszinierten mich und zogen mich magisch an. So kam immer wieder eine neue Versuchung hinzu, der ich mit Leidenschaft und Freude erlag. Es gab Zeiten, da arbeitete ich als Kabarettist in Basel. Ich fuhr dann jeden Abend wieder zurück nach Luzern, machte einen Halt beim Kino Moderne, überprüfte die Eintritte und erledigte die Korrespondenz. Danach ging es ins Kleintheater und ins Atelier-Kino, wo ich dasselbe machte. Es machte mich jeden Tag unglaublich glücklich, wenn ich sehen konnte, dass den Menschen meine Filme gefielen, die ich promotete und auswählte. Ich erinnere mich an den Film „Scharf beobachtete Züge“ von Jiri Menzel aus Tschechien. Ich war der Einzige in der Schweiz, der diesen faszinierenden Film während 21 Wochen spielte. Die Menschen kamen und waren begeistert.
Dueblin: Ihr Antrieb war also, andere Menschen leidenschaftlich zu begeistern.
Emil Steinberger: Ja, das war immer meine innerste Motivation. Ich wollte die Menschen unterhalten, ihre Alltagssorgen ein bisschen zudecken und etwas zeigen, woran sie Freude hatten. Das erzeugt in mir noch heute grosse Glücksgefühle, aus denen ich Energie schöpfen kann. Ich habe diesen Mechanismus zwar immer gelebt, ihn aber vor lauter Arbeit und Projekte erst später vollumfänglich verstanden. Oft frage ich mich heute, wie ich mir das im Alter nun schon wieder antun kann, auf Tournee gehen, wochenlang nicht zuhause sein und von einem Hotel ins nächste reisen. Ich denke mir dann oft, dass ich es doch gar nicht nötig habe. Es ist aber diese Freude, auf der Bühne zu stehen und den Zuschauern etwas zu bieten, die mich motiviert. Was für ein schöneres Geschenk gibt es als in einem Saal zu sitzen, der voll von Menschen ist, die lachen. Das ist ein Geschenk an die Zuschauer, aber auch ein Geschenk an mich, im Grunde genommen, und in Ihrer Sprache als Unternehmer, eine Win win-Situation.
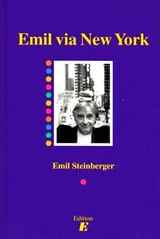
Emil Steinberger: „Emil via New York“. ISBN: 978-390563805
Dueblin: Irgendwann haben Sie den Entscheid getroffen, diesen Abstand zu gewinnen, von dem Sie eben sprachen. Was waren Ihre Gründe, weg nach New York zu gehen? Hat New York auch Ihre Sicht der Schweiz verändert?
Emil Steinberger: Ich würde meinen Weggang nach New York heute als Flucht bezeichnen. Es war eine Flucht von allem, was damals auf mich zukam. Alle wollten etwas von mir und das Geschäft hörte nicht auf. In meinem Buch „Emil via New York“ beschreibe ich auf einer Seite eine typische Woche in meinem damaligen Leben in der Schweiz und was Menschen alles von mir wollten. Dazu kam, dass ich am Morgen in meiner Wohnung die Kirchenglocken läuten hörte, auch abends, und sie kamen mir teilweise wie ein Totenglöckchen vor. Bimbambimbam… Es war neblig und grau draussen, eine etwas depressive Stimmung machte sich breit. Irgendwann kam der Punkt, wo ich weg wollte. Andere Menschen gehen weg, wenn sie 20 oder 25 sind. Sie gehen, reisen und schauen, was es auf der Welt sonst noch gibt. Ich wollte wieder einmal frei atmen, ohne die alltäglichen Belastungen. Auch sehnte ich mich danach, wieder ein Nobody sein zu dürfen, und einfach einmal einen Tag laufen zu lassen, so wie er kommt. Irgendwann wird ein solcher Wunsch so stark, dass man ihn nicht mehr bremsen kann.
Ich hatte nicht lange darüber nachgedacht. Der Entscheid fiel in einer Stunde. Paris war zu nahe, auch London. Ich wollte in eine Stadt gehen, in der ich nach jahrzehntelanger Kulturarbeit auch selber Kultur „tanken“ konnte. Es musste zudem eine weit entfernte Stadt sein, so dass ich nicht nur eine Flugstunde von der Schweiz weg war. Meine Zeit in New York hat sicher auch meine Sicht auf die Schweiz verändert. Ich habe heute einen grösseren Abstand zu vielen Dingen in der Schweiz. Sobald ich damals in der Schweiz etwas sagte, kamen Medien und legten meine Aussagen anders aus als ich es gemeint habe. Ich war wie in einem Käfig. Ich erinnere mich, dass ich mich über die Spinnennetze auf der Kappelbrücke in Luzern äusserte und öffentlich sagte, man solle doch die Neonröhren endlich mal reinigen oder staubsaugen. Eine simple Feststellung und Bemerkung, weil mich das beim Überqueren der Brücke immer wieder störte. Sie können sich nicht vorstellen, was für böse Briefe ich in der Folge erhielt! Man machte mich darauf aufmerksam, dass Spinnen wichtige biologische Nischen besetzen würden und nützlich seien, was ich ja gar nie in Zweifel zog. Es wurde immer enger um mich. Das wollte ich ändern. Ich fühlte mich auch isoliert. Es gab wenige Menschen, die meine Projekte, Visionen und Pläne unterstützten. Ich kann mir das nur damit erklären, dass viele Menschen ein Defizit an Leidenschaft haben, und es ihnen gar nicht in den Sinn kommt, gute Projekte unterstützen zu können.
Dueblin: Diese Isolation, von der Sie sprechen, überrascht, wenn man bedenkt, dass Sie sehr berühmt und auch begehrt sind.
Emil Steinberger: Das ist richtig und vielleicht für viele Menschen auch nicht ganz verständlich. Schauen Sie, wie es Britney Spears geht. Kürzliche Medienberichte zeigten auf, dass sie völlig isoliert von der Aussenwelt lebt. Niemand versteht sie. Es gibt offensichtlich keine Menschen, die mit ihr normal reden und sie mit einem ehrlichen, uneigennützigen Interesse fragen, wie es ihr geht. Es ist alles Glamour. Das spürte ich damals auch in meinem Leben, vielleicht nicht in diesem Ausmass. Für mich war das eine grosse Erkenntnis und Erfahrung, die ich heute nicht missen möchte. Heute lebe ich nicht mehr in Luzern und habe tatsächlich nach meinem Aufenthalt in New York eine gewissen Abstand, der mir gut tut. Meine Frau hat mich sehr unterstützt. Sie hat massgeblich dazu beigetragen, dass ich wieder in die Schweiz zurückgekehrt bin. Sie ist für mich auch eine Art Schutzschild. Sitze ich mit ihr in einem Restaurant in der Schweiz, kommen nur selten Menschen auf mich zu. Sobald meine Frau vom Tisch weggeht, kommen diese Menschen dann und sprechen mich an (lacht).
Dueblin: Herr Steinberger, was wünschen Sie der Schweiz für die Zukunft ganz generell aber auch in Bezug auf Kunst und Kultur?
Emil Steinberger: Ich finde, dass die Schweiz von der Grösse, ihrer geographischen Lage und Vielseitigkeit her eine unglaubliche Idealform hat. Es müssten deshalb in einem solchen Land wahnsinnig tolle kulturelle Aktionen und Projekte möglich sein. Wenn ich zurückschaue auf die letzten 30 Jahre, so sehe ich, dass wir das Geld und die Leute dafür gehabt hätten. Trotzdem habe ich manchmal den Eindruck, als lebten wir alle ein „Eigenbrötlerdasein“, bei dem jeder nur seine eigenen Interessen verfolgt. Es gibt meines Erachtens leider kein engagiertes kulturelles Paket, das Dynamit enthält und mit dem wir der ganzen Welt etwas vormachen könnten.
Ich stelle ebenfalls fest, dass Kultur oft zweit- und drittrangig behandelt wird. Damit spreche ich die Politik, aber auch die Gesellschaft und vor allem Menschen an, welche die Finanzen hätten, Gegensteuer zu geben. Obwalden, um nur ein aktuelles Beispiel zu nennen, hat in einer Abstimmung erst vor kurzem zu einem finanziellen Engagement für Kulturprojekte in Zürich und Luzern nein gesagt. Die Menschen in diesem Kanton geniessen aber seit Jahren in diesen Städten Kultur. Ich finde es schade, dass man nicht etwas offener und grosszügiger ist. Kultur ist nicht immer einfach, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Sie kann sehr schwierig sein und man versteht sie oft nicht auf den ersten Blick. Kultur ist aber wichtig, das sehen wir heute auch bei der Wirtschaftskrise, die bald schon stündlich kulturelle Defizite offenlegt.
Auf der anderen Seite erkenne ich auch grosse positive Tendenzen, die mir wieder Mut machen. Vor 20 oder 30 Jahren gab es erst eine Handvoll Kleintheater in der Schweiz. Heute sind es über 200 an der Zahl. Das ist ein Zeichen, dass vor allem junge Menschen kreativer werden und etwas machen und bewegen wollen. Sie können aber oft mangels Unterstützung die Hürden nicht nehmen, die es in der Kultur ebenfalls gibt. Vieles fällt dann oft mangels Finanzen wieder zusammen und wird flach. Es gibt Politiker, die wohl zu den speziell eifrigen „Verhinderern“ der Kultur gezählt werden müssten, würde man sie einstufen. Im Vergleich zum Sport hat die Kultur eben leider keine genügend grosse Lobby. Das, obwohl wir in der Schweiz unglaublich talentierte (Klein-)Künstler haben, die würdig sind, gefördert zu werden.
Dueblin: Sehr geehrter Herr Steinberger, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen und Ihrer Frau Niccel weiterhin viel Erfolg bei Ihren Projekten und Tätigkeiten!
(C) 2009 by Christian Dueblin. Alle Rechte vorbehalten. Anderweitige Publikationen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors gestattet.
______________________________
Links
– Homepage
– Edition E – Der Verlag für gute Unterhaltung