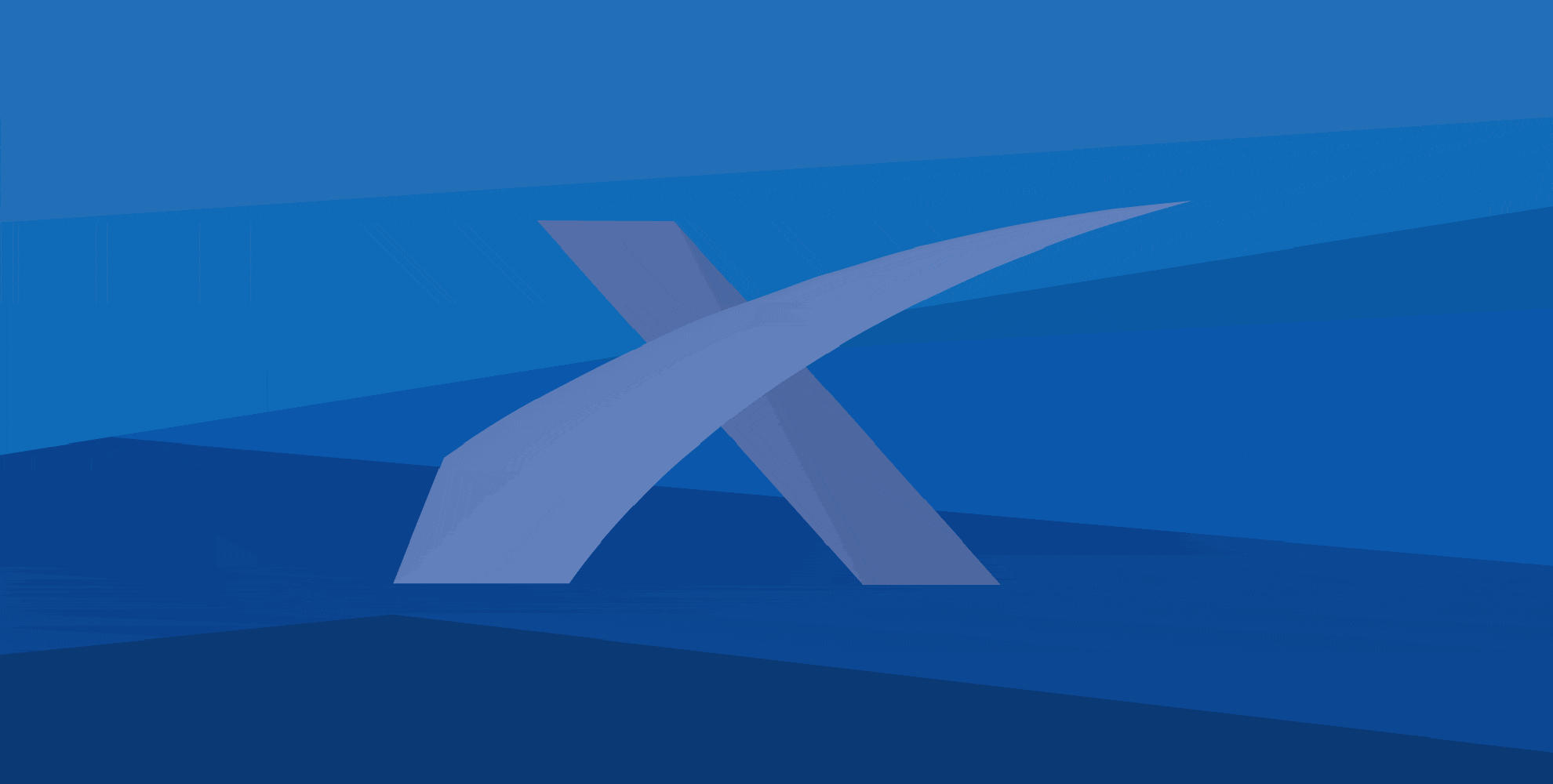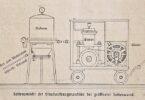Dr. Alexander Gschwind
Dr. Alexander Gschwind, Jahrgang 1950, arbeitete ab 1978 als Auslandsredaktor bei Schweizer Radio DRS (heute SRF) und berichtete über die Vorkommnisse in Nordafrika und auf der iberischen Halbinsel. Der interessierten Leserschaft ist der eben pensionierte Journalist durch seine Berichterstattung für die Sendungen „International“ und „Echo der Zeit“, dem Radioflaggschiff von SRF, bestens bekannt. Gschwind, in Basel geboren und aufgewachsen, studierte Rechtswissenschaften und dissertierte zum Thema „Algerische Verfassungsgeschichte“, ein Umstand, der ihn in frühen Jahren für längere Zeit nach Algerien führte, von wo aus er sich erste praktische Erkenntnisse über die historische und kulturelle Bedeutung des „Mare Nostrum“, wie die Römer das Sammelbecken ums Mittelmeer zu nennen pflegten, aneignen konnte. Von der iberischen Halbinsel aus berichtete Dr. Alexander Gschwind über die Demokratisierungsprozesse Portugals und Spaniens sowie über deren Aufnahme und Integration in die EU. Im Interview mit Christian Dueblin nimmt Dr. Alexander Gschwind Stellung zu Herausforderungen in Iberien und dem Maghreb. Er beschreibt die Vergangenheits- und Zukunftsbewältigung einer Region, die während 800 Jahren von Juden, Mauren und Arabern geprägt wurde. Gschwind zeigt die Überbleibsel aus der Zeit der „Moros“ auf und macht auf interessante Zusammenhänge aufmerksam, die auch heute noch von Belang sind. Gschwind zeigt die Bedeutung und die Auswirkung des Katholizismus in Spanien auf und nimmt Stellung zu Widersprüchlichkeiten in Sachen religiöser Moral und spanischem Alltag. Er geht auf die jüngste Geschichte eines interessanten und schönen Landes ein, das sich bei der Aufarbeitung der Vergangenheit, auch des Franco-Regimes und der Kollaboration mit dem Hitler-Regime, bspw. rund um die Operation Condor und den Einsatz von spanischen Soldaten an der Ostfront (División Azul), auch heute noch sehr schwer tut.
Xecutives.net: Sehr geehrter Herr Gschwind, Sie haben eben ein Buch geschrieben („Diesseits und jenseits von Gibraltar: Als Korrespondent unterwegs in Spanien, Portugal und Nordafrika“, Blaukreuz Verlag Bern, 2015), in dem Sie kritisch aber auch sehr wohlwollend auf Ihre über 30 Jahre lange Berichtserstattungszeit im Maghreb und auf der iberischen Halbinsel zurückblicken. Das Buch besteht aus Episoden, die jede für sich Stoff für ein weiteres Buch geben würden, und es ist mit interessanten Interviews angereichert, die für Menschen, die die Region etwas kennen, von grösstem Interesse sind. Wie kam es zu diesem Buchprojekt?
Dr. Alexander Gschwind: Der Verleger des Buches hatte mich schon vor Jahren angefragt, ob ich in Buchform über mich und meine Tätigkeiten in Spanien und Nordafrika berichten möchte. Er selber war und ist ein grosser Fan der Sendung „Echo der Zeit“, wenn man so will, dem „Flaggschiff“ der schweizerischen Radioberichterstattung, und er hatte meine Kommentare und Berichte stets mit grossem Interesse verfolgt. An einer Autobiographie war ich selber jedoch nicht interessiert. Die Mischung aus Episoden und Interviews aber, wie vom Herausgeber schliesslich vorgeschlagen, fand ich interessant. Im Buch konnte ich am Ende meiner Karriere auch über Fakten berichten, die ich früher als Journalist nicht so hätte beschreiben können, ohne mir Ärger mit der Redaktion einzuhandeln. Ich erzähle mit kritischem Blick Begebenheiten aus den letzten 30 Jahren meiner Berichterstattung und zeige historische und kulturelle Zusammenhänge auf, die mir wichtig erscheinen, um die Region und ihre Entwicklung verstehen zu können.
Xecutives.net: Wie kam es, dass Sie in jungen Jahren schon nach Algerien gingen, um eine Dissertation über das Zustandekommen der algerischen Verfassung zu schreiben?
Dr. Alexander Gschwind: Der Anstoss dafür kam von einem später kläglich gescheiterten Nationalfonds-Projekt zweier damaliger Basler Professoren. Sie wollten eine Art Gesamt-Bilanz afrikanischer Unabhängigkeits-Prozesse erarbeiten lassen und ich sollte am Beispiel Algeriens den schwierigen Umbau einer Unabhängigkeits-Bewegung in einen Nationalstaat analysieren. Wichtigster Gewährsmann für mich war Amar Bentoumi, Algeriens erster Justizminister und einer der beiden „Väter“ der algerischen Unabhängigkeits-Verfassung. Weil er jenes Grundgesetz mit seinem vorbildlichen Grundrechts-Katalog durch dick und dünn gegen alle Aushöhlungs-Versuche durch den Gründerpräsidenten und nachmaligen Diktator Ahmed Ben Bella verteidigte, wurde er von diesem ins Gefängnis gesteckt. Später eröffnete er eine Anwaltskanzlei und dozierte an den Universitäten von Algier und Oran. Er war von meinem Interesse für die Verfassung und die geschichtlichen Zusammenhänge in Algerien geschmeichelt und bot mir an, seine Staatskundekurse für Mittel- und Oberlehrer an der Universität Oran zu übernehmen, womit er sich die lästige Pendlerei zwischen den beiden Städten ersparte. So konnte ich meinen Aufenthalt finanzieren. Die Tätigkeit war sehr spannend und viele Menschen, die ich kennenlernte, haben später Karriere gemacht. Diese Kontakte waren für mich als Journalist sehr interessant und vorteilhaft.
Oran liegt nahe an der algerischen Westgrenze zu Marokko an der Meerenge von Gibraltar. Die iberische Halbinsel liegt gleich gegenüber nur wenige Dutzend Kilometer entfernt. Rund um den Hafen von Oran gibt es viele spanische Restaurants. Zuerst dachte ich, dass das mit dem Handel und der Seeräuberzeit zusammenhing, bis mir klar wurde, dass es sich um geflohene Republikaner handelte, die vor dem Franco-Regime aus Spanien nach Algerien fliehen mussten und sich im Norden Afrikas ein neues Leben aufbauten. Man muss beide Ufer kennen, um den Durchblick zu bekommen und die Zusammenhänge mental erfassen zu können. Das ist die Essenz meiner Erfahrung in diesem Gebiet und wenn wir heute über Flüchtlinge aus Afrika sprechen, sollten wir die Vorkommnisse auch rund um die Zeit Francos nicht ausser Acht lassen.

Dr. Alexander Gschwind, Diesseits und jenseits von Gibraltar
Xecutives.net: Nur wenigen Menschen dürften die geschichtlichen Auswirkungen der maurischen Invasion, die mit Tarik im Jahr 711 begann, klar sein. In Bezug auf diverse Schweizer Berge, Landschaften und Dörfer gehen manche Experten davon aus, dass viele Namen arabischen Ursprungs sind, wie bspw. Allalinhorn, Saas Almagell, Aletsch oder Mischabel. Es gäbe Dutzende Beispiele, die auch eng mit dem Jahr 711 und Iberien zusammenhängen, worüber Ihr Journalistenkollege Dr. Arnold Hottinger, der an dieser Stelle ebenfalls Auskunft gegeben hat, in seinem Buch „Die Mauren. Arabische Kultur in Spanien“ (erschienen im NZZ-Verlag) hervorragend berichtet. Ihr neues Buch erscheint mir die perfekte Anschlusslektüre. Was passierte damals Anfang des 8. Jahrhunderts in Südspanien, dem damaligen Westgotenreich, das bis heute Auswirkungen auf die iberische Halbinsel, den Norden Afrikas und schliesslich auch für uns in Kontinentaleuropa hat?
Dr. Alexander Gschwind: Die wenigsten Menschen, auch in Spanien oder hier in der Schweiz, sind sich dieser geschichtlichen Zusammenhänge bewusst. Viele Fakten haben sich in der offiziellen Geschichtsschreibung nie niedergeschlagen, weil in den Schlachten von Tours und Poitiers (732) der arabische Vorstoss durch das Eingreifen des Franken Karl Martell, dem Onkel von Karl dem Grossen, gestoppt wurde. Er beendete den arabischen Vorstoss nach Europa und schlug die Berberheere zurück. Es kam darum nie zu einer maurischen Besiedlung unserer Gegend. Einzelne Menschen sind damals zwar nördlich der Pyrenäen hängen geblieben. Eine richtige Prägung unserer Kultur durch mehr als maurische Orts- und Landschaftsnamen hat aber nie stattgefunden, ganz im Gegensatz zur iberischen Halbinsel, wo die Mauren während 800 Jahren präsent waren, bis 1492, dem Ende der Reconquista, der Rückeroberung Spaniens durch Ferdinand II. und Isabella I., die sogenannten katholischen Könige (auf Spanisch „Los Reyes Católicos“).
Xecutives.net: Arnold Hottinger stellt in seinem Buch nebst vielem mehr fest, dass rund 1500 Wörter aus dem Arabischen Niederschlag in der spanischen Sprache gefunden haben. Auch zeigt er weitere kulturelle Zusammenhänge auf, die sehr interessant sind. Was sind Ihre persönlichen Erkenntnisse diesbezüglich?
Dr. Alexander Gschwind: Die spanische Kultur war lange Zeit von der arabisch/maurischen Kultur geprägt, 800 Jahre lang, bis zur genannten Reconquista, die mit dem Jahr 1492 weitgehend als abgeschlossen gesehen werden kann. Damals fiel das letzte maurische Königreich in Granada. Mit einem Edikt der katholischen Könige wurde die endgültige Vertreibung der Juden und Mauren von der iberischen Halbinsel in Gang gesetzt. Ihr Exodus sollte unerhörte kulturelle und ökonomische Auswirkungen für diesen Teil der Welt haben, die bis heute nachwirken. Das ganze spanische Vokabular ist, wie Sie richtig feststellen, durchsetzt von arabischen Wörtern und Ausdrücken: vom arabischstämmigen Wort „Arroz“ bspw. stammt unsere Bezeichnung Reis, von „Azúcar“ Zucker. Auch das Wort „Algebra“ ist arabischen Ursprungs. Für mich war immer das arabische Wort „Cerveza“ sehr bezeichnend. Wir sagen auf Deutsch „Bier“, oder auf Italienisch „Birra“ und Französisch „Bière“. Das spanische Wort „Cerveza“ für dasselbe Getränk fällt völlig aus dem Rahmen.
Ich habe im Gegensatz zu Ihnen in Kastilien gelebt und nicht in Andalusien, diese Region aber oft besucht und mich mit der Geschichte Andalusiens befasst. Mir fiel immer wieder auf, wenn ich von Kastilien mit meinem nordafrikanischen Hintergrund nach Andalusien reiste, wie nahe sich Andalusien und der Norden Afrikas sind. In Andalusien angekommen, hatte ich immer das Gefühl, schon mit einem Bein in Nordafrika zu stehen. Mir fiel akustisch und visuell auf, wie stark Andalusien, das auf der iberischen Halbinsel am längsten unter der maurischen Herrschaft stand, bis heute von der maurischen Kultur geprägt ist. Die Art und Weise, wie man auch heute noch verächtlich von den „Moros“ redet – man meint damit den „Underdog“ -, ist das Spiegelbild einer Verdrängung und auch eines Minderwertigkeitskomplexes, der sich schon sehr früh, zur Zeit der Reconquista, entwickelt hatte. Viele Menschen, auch in Spanien, sind sich kaum bewusst, was wir den Arabern und Mauren eigentlich alles zu verdanken haben. Heute sind es noch akademische Kreise, die sich dieser Zusammenhänge, auch des kulturellen Flusses in den Norden, noch im Klaren sind. Die Mathematik, Astronomie bis hin zur Biologie und der Medizin hätten sich in Mitteleuropa sicher ganz anders entwickelt, wenn nicht die sehr hochstehende arabische Kultur auf der iberischen Halbinsel geherrscht hätte.
Den Schweizer Kollegen, die ich in Madrid als Journalist empfangen durfte, riet ich immer, von Madrid zuerst einmal nach Toledo zu reisen und von dort nach Córdoba zu gehen. Man muss in Córdoba die Mezquita (die Mezquita-Catedral de Córdoba) und die Judería gesehen haben, um sich von den arabischen, aber auch sefardisch-jüdischen Einflüssen ein Bild machen zu können. Es gilt, sich dort mit Menschen wie den Philosophen und Ärzten Maimonides und Averroës (Ibn Ruschd) auseinanderzusetzen, die eine wichtige Rolle spielten bei dem von Ihnen beschriebenen Wissenstransfer in den Norden. Erst wenn man sieht, wer damals in Córdoba alles gelebt hat, wer wissenschaftlich tätig war und auf welch hohem kulturellen und wissenschaftlichem Niveau die Menschen damals lebten, kann man verstehen, was sich 1492 für Spanien für eine riesige Katastrophe anbahnte, die bis heute Auswirkungen zeigt. Das Edikt der katholischen Könige, aufgrund dessen damals die Mauren und Juden von der iberischen Halbinsel vertrieben worden sind, hat wirtschaftliche und kulturelle Auswirkungen bis in die heutige Zeit. Die gegenseitige jahrhundertelange Befruchtung dreier Kulturen, also der Juden, Mauren und Christen, war enorm. Trotz einer jahrhundertelangen Reconquista der Christen gegen die Mauren, haben die Mauren die Christen etwa in Córdoba und Granada in Ruhe gelassen und sich nur wenig in religiöse Angelegenheiten eingemischt. Pogrome gegen Andersgläubige, wie sie später von den katholischen Königen gegen Juden und Mauren erlassen wurden, waren ihnen fremd. Wenn man heute die Diskussionen rund um islamischen Fundamentalismus, Glaubenskriege und Intoleranz verfolgt, muss man leider feststellen, dass diese einst gelebte Toleranz schon lange verloren gegangen ist. Unter kriegerischen Umständen, und das sehen wir heute sehr deutlich, geht zuerst die Wahrheit und später die Toleranz verloren.
Xecutives.net: 1492 musste der letzte maurische Herrscher, Boabdil, der Emir von Granada, die Halbinsel verlassen. Sie schreiben in Ihrem Buch sehr kritisch über die Entwicklungen und den Einfluss seither, auch der katholischen Kirche. Christliche Moral und der spanische Alltag können für Aussenstehende oft vollkommen auseinanderklaffen. Ich denke dabei an die vielgepriesene und verehrte Jungfrau Maria, die in jeder spanischen Bar einen Platz an der Wand hat, neben dem TV, wo Fussballspiele und blutige Stierkämpfe ausgetragen werden. Nicht selten hat man auch im Gespräch mit Spaniern den Eindruck, dass eine Säkularisierung nie stattgefunden hat.
Dr. Alexander Gschwind: Ja und nein. Was uns einerseits ins Auge sticht, sind die vielen Kirchen und der starke Einfluss der Kirche vor allem auf die einfachen Leute. Andererseits erkennen Sie in Spanien eine grosse anarchistische Tradition in Katalonien und Andalusien.
Xecutives.net: Wie lässt sich diese Gegenbewegung, der „Anarchismus“, erklären?
Dr. Alexander Gschwind: Die Kirche war immer die ideologische Speerspitze der jeweils herrschenden Schicht, nicht nur in Spanien. Die ganze Reconquista und die Kolonisation weiterer Teile der Welt durch die Spanier ist von Adligen im Namen des Katholizismus vollzogen worden. Der Katholizismus war eine Kriegsideologie, die von den Herrschenden und der Kirche immer sehr zielgerichtet eingesetzt worden ist. Die einfachen Menschen mussten dafür ihr letztes Hemd geben. Sie waren aber jeweils nichts anderes als das gläubige Kanonenfutter im Heer der Eroberer und sie sind von den Adligen und Grossgrundbesitzern über Jahrhunderte hinweg ausgebeutet worden. Heute sind es nicht mehr die Adligen, die herrschen, aber es läuft vieles noch gleich wie damals. Irgendwann war genug und im 19. Jahrhundert erwuchs diesem menschenverachtenden System immer mehr Widerstand, darunter auch von Anarchisten, Leuten, die jegliche Herrschaftsform von Menschen über Menschen aus Prinzip ablehnten. Der Graben zwischen Herrschenden, gleich Katholizismus, und anderen, die nur Opfer waren, gab es schon immer. Die Brutalität der Anarchisten gegenüber den Geistlichen, die sich ab 1936 im spanischen Bürgerkrieg entlud, lässt sich nur mit diesem geschichtlichen Hintergrund erklären. Der jahrhundertelange Hass und das Leiden fanden ein Ventil in der Hinrichtung von Hunderten von Geistlichen.
Xecutives.net: Was ist und war Ihres Erachtens der Einfluss der Kirche in Spanien?
Dr. Alexander Gschwind: Die Kirche hatte in Spanien immer gemeinsame Sache mit den Herrschenden gemacht, auch mit Franco. Der Vatikan war der erste offizielle Staat, der das Putschregime von Franco als Staat anerkannte, zu einer Zeit als Franco noch keine 30% des spanischen Territoriums beherrschte. Und im Übrigen war es der Schweizer Bundesrat Giuseppe Motta, seines Zeichens Katholik aus Airolo, der sich als Zweiter für die Anerkennung des Franco-Regimes ins Zeug legte.
Schauen Sie aber auch ganz aktuelle Gegebenheiten an, die ich in meinem Buch kritisch zu beschreiben versuche: Der Skandal um die Mezquita in Córdoba ist für mich ein schönes und aktuelles Beispiel in Sachen Verhältnis Staat und Kirche in Spanien. Die Kirche hat sich unlängst mit einer Grundbuchverschreibung die Mezquita angeeignet. Diese Vorgehensweise wurde ermöglicht durch ein Gesetz von Franco aus dem Jahr 1946, das er aus Dankbarkeit der Kirche gegenüber erliess und es dieser ermöglicht, Anspruch auf ein Gebäude, ein Kloster, eine Kirche oder ein Pfarrhaus erheben zu dürfen, wobei schon ein banaler Hinweis auf einen katholischen Zweck, den eine Liegenschaft einmal hatte, für eine Grundbuchverschreibung ausreicht.
Für die Menschen in Spanien bedeutet es keinen Widerspruch, auf der einen Seite der Kirche gerecht werden zu wollen und sich auf der anderen Seite mit der materiellen Welt auseinanderzusetzen, die beide für Aussenstehende nicht vereinbar zu sein scheinen. Mein Journalistenkollege und Freund Joe Schelbert, der in einem katholischen Milieu aufgewachsen ist, sagt mir manchmal bei Diskussionen zu diesem Thema, wir seien moralisierende Calvinisten. Die Katholiken haben ein entspanntes Verhältnis zur Weltlichkeit, so sehr sie auch ein verklärtes Verhältnis zur Geistlichkeit haben. Das sind zwei Sachen, die sich für einen Spanier oder Katholiken nicht beissen, auch was die Moral anbelangt.
Man muss sich nicht einbilden, es hätte die Borgias nur in Italien gegeben. Die Kirche war immer mit Verlogenheit behaftet und es machte sich in ihren Kreisen immer ein gewisses Pharisäertum bemerkbar. Das erkennen wir auch, wenn wir die Papst-Dynastien genau betrachten, wo Kriminalität, uneheliche Kinder und Prostitution an der Tagesordnung waren. Diese Vorkommnisse wurden zwar in der Geschichte integriert, jedoch beschönigt oder sogar vertuscht. Selten waren diese Vorkommnisse Anlass für moralische Skandale. Darum ist es auch weiterhin nicht erstaunlich, dass in spanischen Bars neben der Jungfrau Maria der Fernseher mit Fussball oder mit blutigen Stierkämpfen läuft, bei denen die erlegten Stiere den „Virgenes“, den unzähligen heiligen Jungfrauen, gewidmet werden, eine Geste des Respektes diesen religiösen Figuren gegenüber. Fussball, Stierkämpfe und vieles mehr werden von der Kirche ja auch offiziell gesegnet. Das ist für Aussenstehende und Nichtkatholiken tatsächlich schwer verständlich.
Xecutives.net: Wo schlägt sich dieser von aussen gesehen „schizophren“ anmutende Spagat in der spanischen Gesellschaft Ihres Erachtens nieder, politisch und gesellschaftlich gesehen?
Dr. Alexander Gschwind: Ich kann Ihnen diese Frage nicht definitiv beantworten. Das ist das Ergebnis von jahrhundertelanger Verdrängung und rational nicht einfach zu beantworten. Für uns Auswärtige scheint das tatsächlich schizophren. Eine Diskussion mit einem Spanier über diese Zusammenhänge kann in vollkommenes Unverständnis oder gar offenen Streit münden. Ich kann Ihnen aber ein anderes Beispiel nennen, das für Aussenstehende ebenfalls nur schwer verständlich ist. Auch darüber schreibe ich in meinem Buch: Die sogenannte „Legión Española“ ist eine Söldnerarmee, die von Spanien für Spezialeinsätze eingesetzt wird. Sie gilt als besonders mörderisch. Dagegen ist die französische Fremdenlegion eine friedliche Truppe. Man weiss, dass alle Säufer, Schläger und Gewalttätigen, die von der französischen Fremdenlegion nicht mehr aufgenommen oder ausgeschlossen worden sind, bis in die späten Achtzigerjahre von der spanischen Armee in die Legión Española aufgenommen wurden. Die von Franco zunächst in den Rifkriegen anfangs des letzten Jahrhunderts und dann im Bürgerkrieg gegen die Republikaner eingesetzte Legion besteht aus furchtlosen Haudegen, die heute nach Afghanistan und in den Irak gehen und jeden totschlagen, der ihnen über den Weg läuft. Nun, warum erzähle ich Ihnen dies? Fast jeder dieser Soldaten hat eine Kette mit dem Bild der Jungfrau Maria am Hals hängen.
Xecutives.net: Die Blaue Division, ebenfalls ein Teil der spanischen Armee, war an der Ostfront und insbesondere in Stalingrad eingesetzt worden, ein Deal, den Franco mit Hitler einging. Sie schreiben darüber in Ihrem Buch, ein Thema, das Sie offenbar sehr bewegt. Was steckt hinter dieser Blauen Division und deren Wahrnehmung in Spanien?
Dr. Alexander Gschwind: Nach der deutschen Besetzung Frankreichs 1940 bat Hitler Franco zur Kasse für die Unterstützung im Bürgerkrieg durch die berüchtigte Legion Condor, jener deutschen Luftwaffen-Einheit, die unter anderem die baskische Stadt Gernika (kastilisch Guernica) zerstört hatte. Franco versuchte sich zunächst zu drücken, schickte dann aber später ein Freiwilligen-Korps an die Ostfront zum Kampf gegen den gemeinsamen bolschewistischen Feind. Dieses ging als „blaue Division“ (auf Spanisch División Azul) in die Geschichte ein, weil es von Blauhemden (jungen Falangisten) gestellt wurde und auch von einem falangistischen General kommandiert wurde. Damit hielt sich Franco gleichzeitig auch unsichere Kantonisten vom Leib, fürchtete er sich doch vor den sozial-revolutionären Ideen der Falangisten, die seine Kungeleien mit konservativem Klerus und Grossgrundbesitzern misstrauten. Genauso wie in Deutschland viele Jahre lang nach dem Krieg die Entnazifizierung nicht stattgefunden hat und alte Wehrmachtsgeneräle und andere Nazis bei der Gründung der Deutschen Bundeswehr und auch des BND (Bundesnachrichtendienstes) eine grosse Rolle spielten, wurden auch in Spanien solch dunkle Kapitel der Diktatur nie aufgearbeitet, ja noch konsequenter verdrängt als in Deutschland der Nationalsozialismus. Es gab zwar eine inszenierte „Transición“, also einen Übergang vom Franco-Regime zur Demokratie. Sie bestand aus einer gegenseitigen Verzeihungszeremonie zwischen Republikanern und Nationalisten. Viel mehr gab es aber in Spanien nicht.
Den Strich, den man 1978 unter die historischen Gegebenheiten in Spanien ziehen wollte, hat es nie wirklich gegeben. Damals wurde niemand für Verbrechen im Namen von Franco, aber auch auf Seiten der Republikaner, verurteilt. Der ehemalige spanische Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero hatte in den Jahren 2005/2006 die „Ley de la memoria histórica“, ein Gesetz, das die Aufarbeitung des Bürgerkrieges und des Franquismo hätte ermöglichen und regeln sollen, mit Ach und Krach durchs Parlament gebracht. Immerhin fingen damit die ersten grossen nationalen Diskussionen darüber an, Massengräber zu öffnen und Menschen, die damals den Tod fanden, würdig zu bestatten. Auch ging es um die Frage von Entschädigungen für die nachweislichen Opfer des Franco-Regimes. Richtig funktioniert hat das aber alles nicht. Jeder zweite Bürgermeister verbot die Suche und Öffnung solcher Gräber oder stellte sich sonstwie quer. Die Regierung unternahm dagegen nicht viel. Als der spanische Untersuchungsrichter Baltasar Garzón gegen Kriegsverbrechen des Franquismo und gegen Francos Todesschwadronen vorgehen und diese Vorkommnisse aufarbeiten wollte, hat der „Consejo General del Poder Judicial“, das oberste Justizaufsichtsorgan Spaniens, ihn in schöner Einmütigkeit zwischen PSOE (Partido Socialista Obrero Español) und PP (Partido Popular) des Amtes enthoben, unter dem Vorwurf der Amtsanmassung. Wenn man sich diese Rahmenbedingungen vergegenwärtigt, erkennt man die geschichtlichen Probleme, mit denen Spanien bis heute zu kämpfen hat.
Xecutives.net: Interessanterweise können auch heute noch in gewissen spanischen Läden Amulette und Bilderrahmen mit dem Bild von Franco drauf gekauft werden, offenbar ein Verkaufserfolg bei Spaniern, die ihren alten Diktator in guter Erinnerung haben…
Dr. Alexander Gschwind: Die Franco-Zeit ist nach wie vor in vielen Familien, auch was die jungen Menschen anbelangt, ein Tabuthema, über das man nicht sprechen will. Es spaltet ganze Familien. Ich spreche immer wieder mit jungen Spaniern und sie berichten mir, dass das Thema Franco mit den Grosseltern unmöglich und mit den Eltern nur schwierig diskutiert werden könne. Von den Eltern werden die Jungen gar angehalten, nicht öffentlich über diesen Teil der spanischen Geschichte zu sprechen. Das Thema, weil dermassen umstritten, findet auch kaum Eingang in den Schulunterricht. Der tiefe Graben, den Bürgerkrieg und anschliessende Diktatur in die spanische Gesellschaft gerissen haben, ist immer noch offen. Deshalb schweigt man diese Themen immer noch tot.
Franco hatte ja auch seine Sozialpolitik, von der viele Spanier profitierten. Falange war eine sozialfaschistoide Organisation, die Franco unterstützt hatte. Er baute sie in sein Regime ein und verstand es, sie für seine Zwecke einzusetzen. Damit sind wir wieder bei der „blauen Division“, deren unglaubliche Geschichte mich gerade deswegen nicht los lässt! Die „División Española de Voluntarios“, die blaue Division, die aus der Falange hervorgeht, wurde von Agustín Muñoz Grandes geführt, einem Generalskollegen von Franco. Franco, mit seiner klaren Klassenherrschaft, hatte aber bald schon seine Mühe mit der Falange. Er traute den Falangisten nicht und befürchtete eine soziale Revolution von rechts gegen ihn, weil er mit den Grossgrundbesitzern und dem Kapital verbunden war. Das einfache Volk wurde von den Falangisten auf die Seite von Franco geholt, jeweils verbunden mit diversen sozialen Versprechen. Als Franco im zweiten Weltkrieg unter Hitlers Druck geriet, verlangten die Deutschen zunächst die Besetzung des von den Engländern beherrschten Gibraltar. Franco verweigerte sich diesem Ansinnen mit Verweis auf die Schwächung seiner Armee nach dem dreijährigen Bürgerkrieg, was ihm Hitler als Feigheit und mangelnde Solidarität auslegte. Später jedoch, als der Ostfeldzug begann, kam die Anfrage von Berlin nach Madrid, die Ostfront zu unterstützen. Franco verband das Nützliche mit dem Nötigen und entsandte den ungeliebten Generalskollegen Grandes und die Falangisten an die Ostfront, auch nach Stalingrad. Zuerst waren das rund 20‘000 spanische Soldaten, von den Falangisten rekrutiert, die zur Unterstützung von Hitler an die Front entsandt wurden. Die ganze Angelegenheit ist bis heute ein Staatsgeheimnis und die Zahlen der Soldaten, die an der Ostfront als Kanonenfutter für die Deutschen den Tod fanden, sind höchst umstritten. Die wenigsten dieser jungen Soldaten, oft weit unter 20 Jahren alt, kamen nach Spanien zurück. Heute geht man davon aus, dass 150‘000 bis 160‘000 junge spanische Soldaten an der Ostfront ihr Leben verloren haben. Grandes wurde später von Franco kalt gestellt.
Mich haben diese Zusammenhänge immer interessiert und ich spiele immer noch mit dem Gedanken, über die Blaue Division ein Buch zu schreiben. Es ist nur wenig über sie dokumentiert worden. Was überhaupt dokumentiert wurde, wurde später zerstört. Franco hatte zwischen 1944 und 1975 genügend Zeit, sehr viel zu vertuschen und zu beseitigen, was die Blaue Division anbelangt. Er geriet unter Druck, weil Zehntausende von Familien wissen wollten, was mit ihren Söhnen an der Ostfront geschah. Die Blaue Division fristet heute das Schicksal einer Randnotiz, wenn man Geschichtsbücher studiert und Spanien hat es nicht geschafft, diesen Teil seiner Geschichte würdig und wahrheitsgetreu aufzuarbeiten.
Xecutives.net: Die Kirche und das Grossgrundbesitztum, die wir in der Schweiz so nicht kennen, haben Spanien sehr geprägt, bis heute. Das Grossbesitztum der „Terratenientes“ und „Latifundistas“ ist ebenfalls Resultat der Reconquista. Was hat insbesondere das Grossbesitztum auch heute noch für Auswirkungen vor allem im Süden Spaniens?
Dr. Alexander Gschwind: Irgendwelche Lokalmatadore wurden als Rekrutierer für Soldaten engagiert, um Kriege im Dienste der Herrschenden zu führen. Bezahlen konnte man sie nicht mit Geld, sondern nur mit Ländereien. So funktionierten alle Armeen im Mittelalter auch in unseren Breitengraden. Aber nach der bürgerlichen Revolution musste der Adel hierzulande abdanken und hat dabei seine Privilegien, also auch seine Ländereien, verloren. Das hat auch mit der Französische Revolution und vor allem mit der Aufklärung zu tun. In Spanien hat all dies nicht stattgefunden. Die Monarchie besteht bis heute. Natürlich hat der König heute keine weitgehenden Kompetenzen mehr. Mit einem republikanischen kurzen Unterbruch jedoch wurde Spanien immer von einem König beherrscht. Die spanische Republik (1931 bis 1936) hatte viele andere Sorgen und ist gar nicht erst dazu gekommen, sich mit dem Adel anzulegen oder diesen abzuschaffen. Viele Privilegien haben somit bis heute überlebt.
Den Grossgrundbesitz gibt es auch heute noch. In Andalusien ist in den letzten 30 Jahren jedoch viel mechanisiert worden. Man ist nicht mehr in dem Mass auf Arbeitskräfte angewiesen wie früher. Damit gerieten die Tagelöhner und ihre Gewerkschaften zunehmend in die Defensive, weil sie ihre Arbeitskraft nicht mehr als Waffe gegen die Ausbeutung durch die Grossgrundbesitzer einsetzen konnten. Um Gegensteuer zu geben, verabschiedete die Regierung des selbst aus Andalusien stammenden Sozialisten Felipe Gonzalez eine Sonderregelung für diese Tagelöhner im Arbeitslosen-Gesetz, mit perversen Folgen: Man konnte als Landarbeiter schon mit 20 Tagwerken jährlich für das ganze restliche Jahr Arbeitslosengeld beziehen. Ich war selber Zeuge von krassem Missbrauch dieses Systems. Felipe González betrachtete dieses Gesetz als historische Schuld gegenüber den geknechteten Landarbeitern und Taglöhnern. Damit versuchte er auch die Abwanderung der Tagelöhner zu den Kommunisten zu stoppen, die damals mit ihrem charismatischen Anführer Julio Anguita den Sozialisten gerade in Andalusien mächtig einheizten. Aber in der Praxis öffnete das Gesetz dem Missbrauch Tür und Tor. Ich beobachtete in andalusischen Dörfern, wie Väter mit den Stempelkarten ihrer Kinder daherkamen und sich Arbeitslosengeld ausbezahlen liessen, obwohl die Kinder anderswo sehr wohl arbeiteten! So lebten am Ende die Faulpelze einer Familie sehr viel besser als ihre arbeitenden Angehörigen!
Xecutives.net: Spanien, und dort insbesondere Andalusien, steht heute vor riesigen ökonomischen Herausforderungen. Viel Erhofftes, bspw. in Zusammenhang mit der Weltausstellung 1992 in Sevilla, ist nicht eingetroffen. Was sind Ihre Erkenntnisse aus Ihrer Berichterstattung aus dieser Zeit?
Dr. Alexander Gschwind: Das feudale System existiert heute nicht mehr, aber es sind zunehmend einzelne Menschen verschiedenster politischer Couleurs, die im grossen Stil Misswirtschaft und gar Korruption betreiben. Etliche Bürgermeister und Bürgermeisterinnen haben in den letzten Jahrzehnten für sich und ihre Clans grosse Reichtümer angehäuft und sich wenig nachhaltig verhalten. Diese Menschen haben gigantische Schuldenberge hinterlassen, mit denen sich nun die Jungen auseinandersetzen müssen. Podemos und andere junge Parteien treffen heute diese riesigen Schuldenberge an und stehen im Grunde genommen vor unlösbaren Problemen. Sie haben überhaupt Mühe, mangels Geld die kleinsten Bedürfnisse befriedigen zu können. Man darf diese Einstellung vieler Politiker, die solch schamlose Misswirtschaft und Korruption betreiben, getrost als politischen Feudalismus bezeichnen, der das alte Parasitentum des Adels abgelöst hat. Es werden heute nicht Fincas, also Landwirtschaftsbetriebe, mit ihren Mitarbeitenden bis aufs letzte ausgepresst, sondern ganze Städte und man foutiert sich um die anderen Menschen. All dies hat wiederum etwas sehr Parasitäres, mit dem sich das Land auseinandersetzen muss. Man lässt es sich auf Kosten anderer gut gehen und begeht Raubbau an allen möglichen Ressourcen.
In meiner Wahrnehmung, und das ist Ausdruck eines feudalen Verständnisses von Wirtschaft, wird auch heute noch von der Hand in den Mund gelebt. Es wird wenig nachhaltig investiert, was für alle politischen Couleurs gilt. Sie haben die Weltausstellung in Sevilla 1992 genannt, ein gutes Beispiel hierfür. Damals wurde mit Geld der EU die Schnellbahn AVE von Madrid nach Sevilla gebaut. Ich musste am 1. August 1992, dem Tag der Schweiz an der Weltausstellung für verschiedene Schweizer Medien aus Sevilla berichten. Bundesrat Adolf Ogi kam damals, als Vizebundespräsident der Schweiz, nach Sevilla. Das war am Tag, nachdem der Schweizer Kugelstosser Werner Günthör seine Medaillenchancen in Barcelona verspielt hatte, womit die einzige sichere Medaillenchance der Schweiz zu Grabe getragen wurde. Er liess damals unglücklicherweise die Kugel fallen und Sportminister Ogi war am Boden zerstört. Es gab ein Presse-Briefing morgens um 08:00 Uhr, einer für südspanische Verhältnisse unheiligen Zeit. Er bestellte uns ins Hotel Alfonso XIII und jammerte lautstark über besagten Sport-GAU. Die Expo und seine 1. August-Rede an der Weltausstellung waren Nebensache.
Ich blieb noch einen weiteren Tag an der Expo und flog am Sonntagabend nach Madrid zurück. In der offiziellen Statistik war jenes Wochenende dasjenige mit den meisten Besuchern. Am Flughafen San Pablo, der aufgrund der Weltausstellung enorm ausgebaut wurde, traf ich auf 52 Schalter (!), von denen aber bloss deren 4 besetzt waren. An jedem Schalter hingen 4 oder 5 Leute rum. Gleichzeitig wurde die Autobahn nach Sevilla gebaut und der AVE in Betrieb genommen. Die drei brandneuen und millionenteuren Verkehrsträger frassen sich gegenseitig die Benutzer weg! All das, nicht nachhaltig gedacht und geplant, hat bis heute nie rentiert.
Das ganze Expo-Gelände, das ein Technologiepark hätte werden sollen, ist heute so etwas wie ein riesiger Schrottplatz voller verwaister Bauruinen, ein grosses Trauerspiel. Ich bin in diesem Sommer dieser Sache noch einmal nachgegangen und war auch in Lissabon. Portugal, das immer noch eine Spur weltfremder und verschlafener wirkt als Spanien und auf das die Spanier auch gerne herabschauen, hat das viel besser gemacht. Die Portugiesen haben die Expo 1998 ganz bewusst unter dem Titel „Nachhaltigkeit“ entwickelt und geplant. Jedes einzelne Gebäude hatte schon bei der Planung einen anderweitigen Verwendungszweck für die Zeit nach der Ausstellung. Die Nationalbibliothek ist nur ein Beispiel, das Ozeanarium wird weitergeführt und ist ein grosser Publikumsmagnet. Es wurden zudem viele Ausstellungsräume in Wohnungen verwandelt. Das Kabinenbähnchen aus der Schweiz ist heute eine Quartierverkehrsachse für die Bevölkerung von Lissabon. Diese Zweitverwertung hat in Lissabon hervorragend geklappt, im Gegensatz zum spanischen Sevilla, wo man nicht nachhaltig dachte und der erhoffte Sprung ins 21. Jahrhundert nicht so stattgefunden hat, wie das Felipe González, selber aus Sevilla stammend, im Sinn hatte.
Xecutives.net: Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie sich in Andalusien bereits mit einem Bein in Nordafrika sehen. Arnold Hottinger meinte in einem Gespräch dazu sehr treffend, dass es der Fatalismus sei, der dem Süden Spaniens und dem Norden Afrikas gemein wäre. Mir scheint das sehr treffend zu sein, wenn man bspw. die Musik hört, die im Norden Afrikas sehr repetitiv, schon fast meditativ, schwebend, ohne Anfang und Ende, daherkommt. Das zeigt auch etwas die Gesellschaft. Was sind Ihres Erachtens die Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Regionen am Mittelmeer?
Dr. Alexander Gschwind: Ja, das trifft die Stimmung, das Lebensgefühl dort ziemlich genau! Man hat im Norden von Afrika und auch im Süden Spaniens sehr viel Zeit. Man wartet fast auf alles. Das ist eine wichtige Erfahrung. Wenn ich mich an die Vorbereitungen auf meine journalistischen Tätigkeiten in Andalusien für die Expo 1992 zurückerinnere, hat mich damals so gut wie alles ziemlich viel Nerven gekostet! Die Redaktionen in der Schweiz wollten schon im Vorfeld möglichst farbige und anschauliche Reportagen von mir haben und diese dann zur Eröffnung rechtzeitig publizieren können. Aber überall, auf den Baustellen wie in den Büros der Ausstellungsleitung, wurde ich immer nur vertröstet. Auf den folgenden Tag, die kommende Woche, „entonces mañana o la semana que viene“, bekam ich ständig zu hören und ging jedes Mal fast die Wände hoch. Irgendwann beschloss ich grimmig, einfach nicht zu gehen, wenn man mich abwimmeln wollte und blieb in den Vorzimmern stehen. Das ging dann so lange, bis es die Angestellten störte, dass sie nun nicht mehr schwatzen konnten, was sie wollten oder ich Zeuge davon hätte werden können, dass sie den ganzen Tag nichts tun. Dieses Rezept verfolge ich bis heute auch in nordafrikanischen Amtsstuben und es funktioniert eigentlich fast immer!
Xecutives.net: Auch das Warten gehört zum fatalistischen Teil, der die Menschen prägt. Eine Immatrikulation an der Universität kann problemlos einen ganzen Tag dauern, weil man stundenlang anstehen muss, um einen simplen Stempel zu bekommen. Die Studenten richten sich danach und nehmen gleich ihre Mahlzeiten mit, um beim Warten nicht zu verhungern. Sie stellen sich innerlich mit einer Gelassenheit auf das Warten ein. Für viele Schweizer wäre das undenkbar und unerträglich.
Dr. Alexander Gschwind: Das hat damit zu tun, dass nie etwas besser wird oder sich ändert und man einfach wartet, bis etwas passiert. Es zeigt aber auch, wie es sich mit dem Arbeitsmarkt verhält. Es gibt zu wenig Arbeit und man ist überhaupt froh, wenn man zwei Mal am Tag etwas zu essen hat. Dann kommen die klimatischen Bedingungen dazu. Es ist nicht einfach, bei 50°C im Schatten auf einer Finca oder auf der Strasse zu arbeiten. Ich erinnere mich an eine Begebenheit in Nordafrika: Ich war in der Westsahara und hatte einen Termin mit einem wichtigen Vertreter der saharauischen Befreiungsfront POLISARIO vereinbart. Es war nicht einfach, dorthin zu gelangen. Es bedurfte etlicher Passierscheine, bis man im Lager ankam. Besagter Termin wurde mir mehrere Male bestätigt. Die Lage der Flüchtlinge in den Lagern rund um die algerische Oase Tindouf ist sehr verzweifelt, zumal sich die Weltöffentlichkeit kaum für sie interessiert im Gegensatz etwa zu den Palästinensern oder heute zu den Syrern oder Afghanen. Umso wichtiger wäre es darüber zu berichten und an das traurige Schicksal dieser Leute zu erinnern. Ich habe dies als Korrespondent immer auch als meine moralische Pflicht verstanden, gegen kollektives Vergessen und Verdrängen anzukämpfen. Ich sprach mit Vertretern der UNO und wollte nun vor Ort mit Verantwortlichen sprechen, um direkt zu Informationen zu gelangen. Aber auch dort wurde ich immer wieder vertröstet, tagelang! Irgendwann platzte mir der Kragen und ich begann mich lautstark zu beschweren. Als das Gespräch dann doch endlich zustande kam, versuchte ich dem POLISARIO-Mann zu erklären, wie sehr solches Verhalten seiner Sache schade und Sympathien koste, auf die er und seine Leute doch dringend angewiesen wären. Seine Antwort war entwaffnend und machte mich völlig sprachlos: „Ihr rechnet die Zeit in Sekunden, Minuten und Stunden. Wir Nomaden in Tagen, Wochen, Monaten und Jahren, weil Zeit das einzige ist, was wir im Überfluss haben. Diese Mentalität und Einstellung ist tatsächlich auch in Andalusien anzutreffen und sie kann als Erbe der maurischen Kultur betrachtet werden. Der POLISARIO-Mann brachte dieses unterschiedliche Zeitverständnis mit seiner lakonischen Lektion auf den Punkt und ich habe sie deshalb bis heute nicht vergessen. Die Zeit als Endlosschlaufe widerspiegelt sich auch in der andalusischen Musik beidseits der Meerenge von Gibraltar wie Arnold Hottinger sehr treffend vermerkt!
Xecutives.net: Was ist es, was Sie heute, zurück in der Schweiz, an Spanien besonders vermissen?
Dr. Alexander Gschwind: Das viel entspanntere Lebensgefühl, die Tatsache, dass man sich in Spanien aus dem Nichts ein Vergnügen machen kann. Die langen lauen Nächte, die man gerade in Andalusien hat, verführen dazu, sich draussen zu bewegen und mit anderen Menschen zusammen zu sein. Das soziale Leben spielt sich nicht in der Wohnung ab. Man trifft sich, man tanzt und man singt zu Musik, die gratis zu haben ist oder die man vor Ort auch gleich selber spielt. Nirgendwo gibt es doch so viele Bars wie in Spanien, wo man sich zum Bier und zum Schwatz trifft! Ich würde mir daher für die Schweiz etwas weniger Verbiesterung und Verkrampfung, dafür mehr Unbefangenheit und Entspanntheit wünschen. Natürlich sind gewisse Eigenschaften klimatisch bedingt, andere kulturhistorisch. Es wird aber in Spanien definitiv mehr gelacht als hier in der Schweiz, wo jeder zielstrebig und oft eben auch geradezu verbissen seiner Sache nachgeht.
Xecutives.net: Sehr geehrter Herr Gschwind, ich bedanke mich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin viel Freude und Erkenntnisse bei Ihren Recherchen sowie viel Gesundheit!
(C) 2015 by Christian Dueblin. Alle Rechte vorbehalten. Anderweitige Publikationen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors gestattet.
______________________________
Links
– mehr zum Buch „Diesseits und jenseits von Gibraltar“
– auf SRF