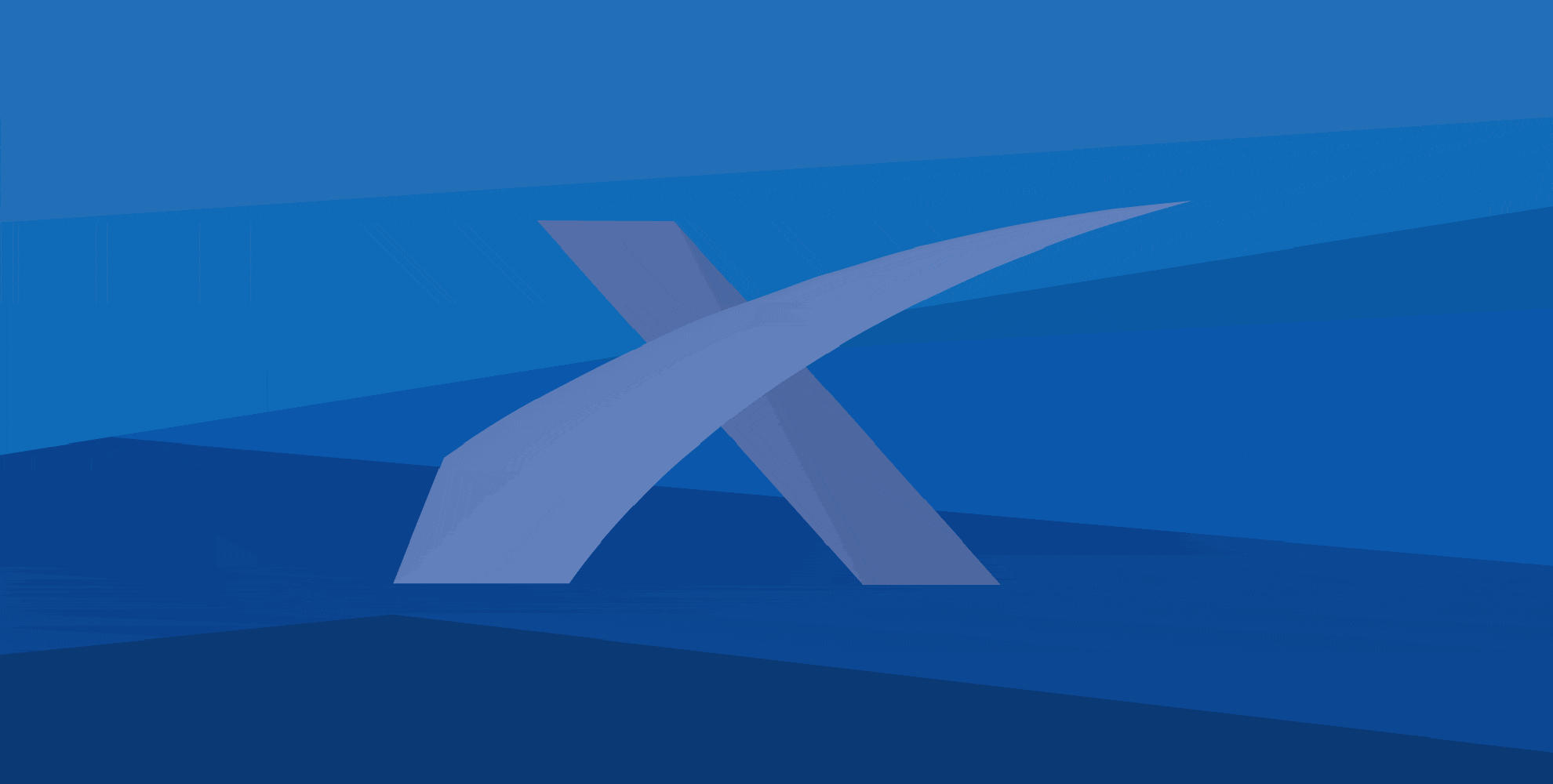Daniel Küng
Daniel Küng, Jahrgang 1952, leitet seit 2004 die Osec, die Schweizerische Aussenhandelsförderung mit Sitz in Zürich. Die Osec ist ein privatrechtlich organisierter Verein, der vom Bund subventioniert wird. Im Gegenzug muss die Osec Leistungsaufträge erfüllen, allen voran die Förderung des Exports. Daniel Küng’s Karriere bei der Osec ging eine fast Dreissigjährige Tätigkeit als Unternehmer im Ausland voran. Sie führte ihn nach Brasilien, und in viele andere Länder. Kurz vor seiner Berufung als Chef der Osec verkaufte der HSG-Ökonom sein Unternehmen in Portugal, wo er 17 Jahre seines Lebens verbrachte. Daniel Küng gilt als ausgewiesener Experte der Schweizer Exportwirtschaft. Im Interview mit Christian Dueblin spricht Küng über die Rolle der Schweiz auf dem internationalen Markt und macht auf Herausforderungen der Exportwirtschaft aufmerksam, die unter einem starken Franken grosse Leistungen erbringen muss. Nur wer es schaffe, sich den neuen Gegebenheiten mit den richtigen Massnahmen richtig anzupassen, werde langfristig erfolgreich bleiben können, lautet Küng’s Credo. Der Staat müsse die richtigen Strukturen schaffen, so dass Unternehmen sich von der Schweiz angezogen fühlten. Allem voran gelte es, sich mit Freihandelsabkommen intensiv auseinanderzusetzen und die laufenden Verhandlungen mit den diversen potentiellen Partnerländern voranzutreiben.
Dueblin: Sehr geehrter Herr Küng, bevor wir auf die momentanen Herausforderungen der Schweizer Exportwirtschaft zu sprechen kommen, für die Sie als Direktor der Osec seit 2004 tätig sind, möchte ich Sie fragen, was Sie damals bewogen hatte, nach einer erfolgreichen unternehmerischen Tätigkeit aus Portugal zurück in die Schweiz zu kommen.
Daniel Küng: Ich muss hier gleich eine kleine Berichtigung anbringen. Es hatte mich damals nichts bewogen, in die Schweiz zurückzukommen. Es war auch nach 27 Jahren als Unternehmer im Ausland nie mein Ziel, wieder in die Schweiz zurückzukommen. Als man aber den Posten eines Osec-Chefs an mich herangetragen hatte, musste ich Entscheide treffen. Einer Tätigkeit als Chef der Osec kann man nicht fern im Ausland gerecht werden. Weil mir diese Herausforderung aber grosse Freude bereitete, entschied ich mich, in die Schweiz zurückzukehren, ein Entscheid, den ich zuvor nie in Betracht gezogen hatte und den ich bis heute auch nie bereut habe (lacht).
Dueblin: Sie waren Unternehmer und zuletzt auch in Portugal tätig, wo Sie eine Contract Service Organisation, CSO, mit rund 150 Angestellten führten.
Daniel Küng: Ich war damals mit meinen Partnern und Angestellten hauptsächlich für die Pharma-Industrie tätig. Im Jahr 1997, als ich die Firma aufbaute, war der Betrieb der Firma noch vorwiegend ein nationales Geschäft. In jedem Land verhandelten die Pharma-Firmen mit den CSOs. Es ging dabei vom Flotten-Management, über Clinical Trials bis hin zu ganzen Verkaufsequipen, die wir für die grossen Firmen im Rahmen ihrer Outsourcing-Programme organisierten und zur Verfügung stellten. Bei der Fokussierung auf ihre Core competences lagerten viele Unternehmen alles aus, was nicht in ihrem geschäftlichen Kernbereich lag. Im Zuge der Europäisierung und Internationalisierung der Geschäfte fingen diese Unternehmen aber an, internationale, grosse CSOs für ihre Outsourcing-Geschäfte zu beauftragen. Die Ansprechpartner waren nun nicht mehr länderspezifisch, sondern länderübergreifend tätig. Das hatte zur Folge, dass sich auch die CSOs anpassen mussten. Als Marktführer in Portugal waren wir zwar nicht klein, aber es wäre eine sehr grosse Herausforderung gewesen, einen grossen Konkurrenten aufzukaufen. Wir hatten laufend Kaufangebote auf dem Tisch und entschieden uns, das Geschäft im Jahr 2003 an den Europamarktführer zu verkaufen.
Dueblin: Sie waren selber Präsident der portugiesisch-schweizerischen Handelskammer. Was haben Sie dort als Auslandschweizer für Erfahrungen gemacht?
Daniel Küng: Ich bin einige Jahre Präsident dieser Handelskammer gewesen und habe dort beste Kontakte zu Unternehmen in der Schweiz und in Portugal gepflegt. Später wurde ich in den Dachverband dieser Handelskammern gewählt, in die Swisscham. Dort hatte ich bereits mit der Osec zu tun. Sie funktionierte damals nicht so, wie ich mir das hätte vorstellen können und war nicht gut geführt. Als Unternehmer mit vielen Jahren Auslanderfahrung war mir klar, wie wichtig eine Osec für die Exportunternehmen in der Schweiz ist. Mir war klar, dass es vor allem die KMUs waren, denen man gewisse Dienstleitungen anbieten musste, um ihnen den Einstieg in andere Länder zu vereinfachen. Die grossen Multis, die selber mit viel personellem Aufwand in der ganzen Welt tätig sind, waren in einer weitaus besseren Ausgangslage als manches KMU, das in anderen Ländern Fuss fassen wollte. Als mein Vorgänger dann seinen Platz räumen musste und die Stelle als Osec-Chef frei wurde, habe ich mich für dieses Amt beworben und kam nach rund 28 Jahren in die Schweiz zurück.

osec – Business Network Switzerland
Dueblin: Die Schweiz befindet sich in Sachen Export in einer schwierigen Lage. Wo sehen Sie als Leiter der Osec, aber auch als HSG-Ökonom und ehemaliger Unternehmer, die derzeitigen Chancen und Probleme der Schweizer Exportindustrie?
Daniel Küng: Ich denke, dass sich zurzeit das Alleinstehen der kleinen Schweiz in der Landschaft von immer globaler werdenden grossen Playern als schwierige Situation manifestiert. Wären wir ein grosses Land, wäre das unter denselben Bedingungen wohl anders. Für ein so kleines Land wie die Schweiz ist es aber sehr schwierig, sich behaupten zu können. Viele Menschen, die wohl auch gegen einen Beitritt der Schweiz zu einer EU waren, haben sich gedacht, dass die kleine Schweiz als Oase in der Wüste gut überleben könne. Heute müssen auch diese Menschen einsehen, dass dieser Weg zunehmend schwieriger wird. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren drastisch verändert, zum Nachteil der Schweiz. Die Oase kann ausgetrocknet werden. Der Druck des starken Frankens ist im Moment für die Exportwirtschaft enorm. Wir sehen das auch an den Reaktionen der Schweizerischen Nationalbank. Wir sind ähnlich unter Druck, wie ein durchschnittliches EU-Land. Für die Exportindustrie hätte sich ein Beitritt zur EU im Nachhinein gesehen wohl positiv ausgewirkt. Im grossen und ganzen ist es uns mit der Alleinstellung nicht gelungen, was die volkswirtschaftlichen Auswirkungen betrifft, eine Differenzierung von den EU-Ländern herbeizuführen. Wir leiden heute an ganz anderen Mechanismen. Wir bewegen uns innerhalb einer gewissen Schmerzgrenze in Bezug auf den Frankenkurs, die es uns gerade noch erlaubt, uns einigermassen halten zu können. Wir leiden also wie unsere europäischen Nachbarn ebenfalls – einfach aus anderen Gründen.
Dueblin: Was kann die Schweiz Ihres Erachtens aus dieser Situation machen, um den Anschluss nicht zu verlieren und ihr wirtschaftliches Niveau auch längerfristig zu halten?
Daniel Küng: Es bilden sich zum einen grosse Blöcke in Südamerika, in Asien aber eben auch in Europa. Diesen immer grösser werdenden Blöcken geht es schlicht um Marktmacht. Die Schweiz hat sich gegenteilig verhalten. Sie hat sich keinen dieser Blöcke anschliessen wollen und suchte, wie eben dargestellt, mit einem Alleingang eine Differenzierung zu erreichen.
Zum anderen gibt es den Substitutionsdruck, den man nicht unterschätzen darf. In allen internationalen Gremien, in denen die Schweiz vertreten ist, schwindet ihr Einfluss schon seit vielen Jahren. Aufstrebende Länder, wie beispielsweise die BRIC-Länder, versuchen erfolgreich, ihren Einfluss in diesen Gremien und Institutionen auszubauen. Auch hier gehört die Schweiz zu den Verlierern. Sie ist zu klein, um sich durchsetzen zu können. Die Schweiz hat in vielen Angelegenheiten schlicht überhaupt kein Gewicht und muss sich immer mehr Entscheiden von grossen Ländern oder Blöcken fügen. Es drängen Volkswirtschaften mit mehr als hundert Millionen Einwohnern an die Hebel der Macht und da ist es nun halt mal so, dass kleinere Länder, die nicht einem grossen Block angehören, Platz machen müssen. Das bringt Substitutionseffekte mit sich, die zu Lasten von kleineren Ländern, wie der Schweiz, gehen.
Dueblin: Sie haben sich in den letzten Jahren sehr für gewisse Freihandelsabkommen eingesetzt, so auch für das Freihandelsabkommen mit China. Was kann die Schweiz von diesen Abkommen profitieren und warum sind sie so wichtig?
Daniel Küng: Diese Abkommen sind, wenn Sie so wollen, das einzige Tor zur Welt, das uns zurzeit weiterbringen kann. Warum soll sich ein ausländisches Unternehmen in der Schweiz ansiedeln, Know-how und Technologie bringen und sich hier finanziell engagieren, wenn die Schweiz nicht eine ausgezeichnete Plattform ist, um international tätig zu sein? Unser eigener Markt ist zu klein für diese Firmen. Wir müssen also dafür sorgen, dass wir den Zugang zu den Märkten aufrechterhalten und ausbauen können. Davon profitieren auch die KMUs in der Schweiz. Wir müssen also dafür sorgen, dass wir weiterhin für ausländische Firmen interessant sind und nicht plötzlich völlig abgekapselt dastehen, ohne diesen Firmen Vorteile auf dem internationalen Markt bringen zu können. Die einzige Möglichkeit, die wir zurzeit haben, sind die von Ihnen angesprochenen Freihandelsabkommen. Sie bringen uns klare komparative Vorteile.
Dueblin: Welches sind die Freihandelsabkommen, denen Ihres Erachtens besondere Beachtung beigemessen werden müsste?
Daniel Küng: Für mich sind die schnell wachsenden Märkte wie Indien und China, später vielleicht auch Russland, von grösster Bedeutung. Zu denken gilt es aber auch an Länder wie Indonesien, das auch für die Schweizer Industrie aufgrund seiner Rohstoffe immer wichtiger wird. Wir sind mit unseren Verhandlungen deutlich weiter, als das beispielsweise die EU ist. Können wir diese Freihandelsabkommen vor der EU abschliessen, so hat unsere Wirtschaft ein sogenanntes „Window of opportunity“, das von grossem Vorteil für die Schweizer Wirtschaft wäre. Dieses „Window“ könnte einige Jahre genutzt werden, um sich auf den Märkten erfolgreich positionieren zu können. Das ist enorm wichtig. Gerade mit Indien, China und Indonesien sprechen wir schon von rund 40% der Weltbevölkerung, sprich von einem riesigen Markt, der sich uns auftut. Zudem handelt es sich um die stärkst wachsenden Länder auf der Welt. Damit sollte man diesen Ländern grosse Aufmerksamkeit widmen und alles dafür tun, dass mit ihnen Freihandelsabkommen abgeschlossen werden können.
Gerade der starke Franken zwingt viele Unternehmen schon jetzt und mehr als in der Vergangenheit, schnell und zügig ausserhalb der EU neue Märkte zu suchen. Was stellen Sie diesbezüglich über die Arbeit bei der Osec fest? Der starke Franken ist tatsächlich ein weiterer guter Grund für die Schweiz, Freihandelsabkommen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Ländern zu verstärken, die nicht mit dem Euro abrechnen. Wie Sie richtig feststellen, sind bereits viele Unternehmen seit der Frankenkrise in diesen stark wachsenden Ländern wie Indien, China oder Brasilien tätig. Diese Unternehmen, die dort Fuss fassen oder bereits Fuss gefasst haben, können mittelfristig das Problem ihrer gedrückten Margen zumindest teilweise lösen, ein Problem, das sich langfristig schlecht auf unsere Wirtschaft auswirken wird. Auch die Türkei und Japan gehören zu den Ländern, die zurzeit von schweizerischen KMU gepflegt werden und in denen wir deutlich mehr Engagement von KMU verspüren.
Dueblin: Sie sprechen die langfristige Schwächung der Schweiz durch den für die Schweizer Exportindustrie sehr nachteiligen Frankenkurs an. Wie wird sich diese Schwächung vollziehen?
Daniel Küng: Wir haben hier in der Schweiz deflationäre Effekte von 1 bis 1,5%. Im Euroraum verzeichnen wir inflationäre Effekte von rund 2%. Wir haben damit, vereinfacht gesagt, eine rund dreiprozentige Korrektur vom paritätischen Wechselkurs pro Jahr. Es dürfte eine Frage von 4 bis 5 Jahren sein, bis der paritätische Wechselkurs auf 1,20 ist. Mit jedem Jahr tut der nachteilige Wechselkurs etwas weniger weh. Jedes Jahr ist aber ein Jahr der gedrückten Margen. In dieser Zeit stehen weniger Mittel zur Verfügung, um zu investieren. Wir sind gemäss WEF das wettbewerbsfähigste Land, weil wir das innovativste Land sind. Darum riskieren wir gerade im Moment aufgrund des eben Gesagten, unsere Innovationsfähigkeit und -kraft zu verlieren. Das sind keine guten Zeichen und Voraussetzungen für die Schweiz. Unsere Firmen haben in den vergangenen Jahren ihre Margen im Innovationsbereich optimal eingesetzt. Das könnte sich nun in den nächsten Jahren ändern, was schliesslich auch dazu führen könnte, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Wir spüren das, wie bei vielen Dingen, heute noch nicht. Es ist darum wichtig, dass wir für die Exportunternehmen nicht nur langfristige Wege finden, sondern es auch mittelfristig schaffen, aus dem Würgegriff des Euros herauszukommen.
Dueblin: Die Osec hat kürzlich veröffentlicht, dass noch der Juli 2012 einer der erfolgreichsten Handelsbilanzüberschussmonate der Vergangenheit war. Wie lässt sich dieser, möglicherweise auch etwas trügerische, Erfolg erklären?
Daniel Küng: Es ist auch das erste Mal seit langer Zeit, dass wir kein negatives Wachstum verzeichnet haben. Firmen fangen an, sich anzupassen. Ich war im Frühjahr auf der ISM (Internationale Süsswaren Messe) in Köln, um mit Unternehmern zu sprechen und mir ein Bild zu machen. Ich bin von einem Unternehmer auf eine Veranstaltung der Osec aus dem Jahre 2010 angesprochen worden. Damals hatten wir schon sehr früh aufgezeigt, wie sich Unternehmen gegen die Währungsproblematik wehren können. Er sprach die Empfehlung der Osec an, im Ausland schnellstmöglich neue Märkte zu finden. Offenbar hatte der Unternehmer auch schon im 2011 die ersten diesbezüglichen Schritte veranlasst. Er hat sich nun offenbar mit seinem Unternehmen in Rekordzeit drei neue Märkte eröffnet und erklärte mir seine Vertriebsstrukturen. Er meinte, dass ihn mit jedem Tag das Euro-Problem weniger stören würde.
Dueblin: Viele Unternehmen aber haben das nicht gemacht, oder konnten sich ein solches Vorgehen aus Ressourcengründen nicht leisten. Andere folgten dem Prinzip Hoffnung und unterschätzten die Euro-Krise und ihre Auswirkungen auf die Margen…
Daniel Küng: … ja, dem ist sicher so. Viele meinten, dass der Aufbau von Vertriebsstrukturen zu lange dauern würde und wollten nicht erkennen, dass wir mit einem Problem konfrontiert sind, das Jahre braucht, bis es gelöst ist. Ich habe eben in einem Le Temps-Interview gesagt, dass diese Unternehmen, die immer noch zuwarten, bis sie ihre Vertriebsstrukturen verändern und anpassen, das Risiko laufen, ihre Defizite nicht mehr aufholen zu können. Was würde beispielsweise geschehen, wenn die Nationalbank, aus irgendwelchen Gründen, die wir noch nicht kennen, den derzeitigen Kurs nicht mehr halten kann oder will? Ich bin für die Schweiz grundsätzlich zuversichtlich. Die Zeichen der Zeit sind von den meisten Unternehmern verstanden worden. Ein Unternehmen kann sich aber heute nicht erlauben, zuzuwarten, bis jemand das Problem für einen löst. Diese Anpassungen, um auf Ihre Frage zurückzukommen, haben dazu geführt, dass der Handelsbilanzüberschuss in Rekordnähe rückte. Das ist ein Resultat von Kostensenkungsprogrammen, Veränderungen in der Vertriebsstruktur, der Verkürzung von Innovationszyklen und beispielsweise Geschäften in anderen Märkten.
Dueblin: Es scheint, dass manch ein Unternehmen auch die Swissness wieder für ihre Geschäfte nutzt, mehr als das noch in den vergangenen Jahren der Fall war. Auch auf diesen Punkt machen Sie über die Osec immer wieder aufmerksam.
Daniel Küng: Das ist richtig. Ich habe fast 30 Jahr im Ausland gelebt und mit Swissness immer gute Erfahrungen gemacht. Das Ausland schätzt Produkte aus der Schweiz. Sie werden mit Zuverlässigkeit, Innovation und Qualität verbunden. Das sind Früchte von jahrzehntelanger guter Arbeit in der Schweizer Industrie. Diese Vorteile, die man unseren Produkten beimisst, sollten wir zu verkaufen wissen. Darum sprechen wir in der Osec immer wieder von „Swissness“.
Dueblin: Sie selber waren lange Jahre ein Auslandschweizer und dabei immer sehr gut vernetzt. Die Frage der Auslandschweizer wird in der Schweiz sehr politisch angegangen, was unternehmerisch nicht förderlich ist und von vielen Auslandschweizern auch nicht geschätzt wird. Warum will es der Schweiz seit Jahren von offizieller Seite nicht gelingen, die rund 750’000 Auslandschweizer/innen vermehrt zu aktivieren und dieses Potential richtig für die Schweiz zu nutzen? Was haben Sie selber während fast 30 Jahren im Ausland diesbezüglich für Erfahrungen gemacht?
Daniel Küng: Es passiert nur wenig einfach von selber. Man muss diese Schweizerinnen und Schweizer, die teilweise bedeutende Stellungen im Ausland einnehmen und grosses Fachwissen aufweisen, richtig mobilisieren. Wir haben darum in der Osec angefangen „Peer to Peer-Events“ anzubieten. Wenn Sie mit Ihrem Unternehmen beispielsweise nach Indonesien gehen möchten, dann übernehmen wir nebst Feasability-Untersuchungen und Marktanalysen auch die Aufgabe, Sie mit anderen Schweizer Unternehmern und Unternehmerinnen, die ebenfalls in diesen Ländern tätig sind, bekannt zu machen. Wir würden dann aber auch erwarten, dass Sie sich ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt für ein Frühstück oder für einen Event mit anderen schweizerischen Unternehmen zur Verfügung stellen, um Erfahrungen auszutauschen. Das klappt in der Regel sehr gut und Schweizer Unternehmen, die in anderen Ländern tätig sind, stellen ihr Know-how gerne anderen Schweizer Unternehmen zur Verfügung. Sie haben das ja selber mit Schweizer Arbeitgebern in Mexiko und Brasilien zusammen mit der Osec erlebt und gesehen, was solche Kontakte gerade für KMU für eine Bedeutung haben. Aus Kontakten mit anderen Unternehmen, die schon in anderen Ländern Fuss gefasst haben, kann man von Fehlern lernen, die man nicht unbedingt selber auch noch machen muss. Das kann bedeutende zeitliche und finanzielle Einsparungen mit sich bringen.
Dueblin: Warum tut sich Ihres Erachtens gerade ein so kleines Land wie die Schweiz mit so vielen Auslandschweizer/innen so schwer, diesen Umstand auch wirtschaftlich optimal zu nutzen?
Daniel Küng: Es ist eben so, dass diese Zusammenarbeit nicht selbstverständlich ist. Der Schweiz fehlt es hier am Zusammenhalt, die eine jüdische Gemeinde, aber auch etwa eine armenische, irische oder schottische Gemeinschaft im Ausland kultiviert. Oft sind diese Menschen sehr gut organisiert und sorgen dafür, dass Bürger des eigenen Landes vorwärtskommen. Das hat geschichtliche Gründe. Solche Länder und Völker standen oft unter starkem politischem Druck, was sich darin zeigt, dass sie einander gegenüber sehr solidarisch eingestellt sind. Im Kleinen klappt das auch bei uns nicht so schlecht. Vor einiger Zeit haben wir über die Osec beispielsweise einem Unternehmen, das in der Sicherheitstechnik tätig ist, geholfen, in Brasilien Fuss zu fassen. Etwas später dann sind wir von einem anderen Schweizer Sicherheitstechnikunternehmen, das nicht eine direkte Konkurrentin des ersten Unternehmens ist, angegangen worden. Es hat sich nun aufgrund unserer Vermittlung ergeben, dass das erste Unternehmen das zweite Unternehmen aus der Schweiz massgeblich unterstützt hat. Für das erste Unternehmen kann das auch geschäftlich interessant sein, da es z.B. zusammen mit der zweiten Unternehmung besser und umfassender offerieren kann.
Aber um noch einmal auf Ihre Frage zurückzukommen: Als ich damals in Portugal war, habe ich eine Vereinigung geführt, die „Les hommes d‘ affaires suisses“ hiess. Es gab diese Organisation im Kern schon. Zur Zeit der Diktatur in Portugal haben sich grosse Schweizer Firmen, dazu gehörten damals auch eine Roche, Ciba und Nestlé, immer wieder inoffiziell getroffen und man diskutierte über die wirtschaftliche und politische Situation im Gastland und half sich gegenseitig, wenn das nötig war. Natürlich war es auch das gesellschaftliche Element, das diese Menschen fern der Schweiz zusammenführte. Man traf sich ein Mal im Monat zum Abendessen. Ich erinnere mich, dass immer auch sehr bedeutende Chefs dabei waren. Paul Bulcke beispielsweise war als damaliger Länderchef von Nestlé in Portugal ebenfalls immer wieder mal Gast, wie viele andere bedeutende Unternehmer auch. Als Sozialplattform schaffte es diese Vereinigung, den Handelskammern angegliedert zu werden. Das war zu der Zeit, als ich Handelskammer-Präsident geworden bin. Schliesslich wurde diese Organisation in die Handelskammer integriert. Das führte zwischen den Schweizer Unternehmen zu „kurzen Drähten“. Das hat sich für alle sehr positiv ausgewirkt. Damit will ich nur aufzeigen, dass man mit etwas Initiative viel bewirken kann. Und es gibt viele ähnliche Beispiele auf der Welt.
Dueblin: Die Osec scheint mir für Vieles eine Art Katalysator zu sein. Die Mittel, die der Exportförderung jedoch in der Schweiz zur Verfügung stehen, sind im Vergleich zu anderen Ländern jedoch sehr gering. Warum ist das so?
Daniel Küng: Absolut, die Osec versteht sich wie Sie sagen als Katalysator für die Exportförderung. Wir stellen fest, dass es oft die Soft factors sind, die unsere KMU herausfordern. Darum versuchen wir mit Spezialisten vor Ort, den Schweizer Unternehmen zu helfen. Es geht aber auch um Fragen wie die Konsolidierung einer Buchhaltung in einem exotischen Land, bis hin zu Hilfestellungen bei rechtlichen oder administrativen Herausforderungen. Aber es ist sicher so, wie Sie das festgestellt haben. Verglichen mit anderen Ländern ist unsere Exportförderung sehr klein. Denken Sie an Länder wie Finnland, Österreich aber auch Deutschland und Frankreich, denen im Vergleich zu ihrer Wirtschaft viel grössere staatliche Gelder für den Export zur Verfügung stehen. Das ist aber nichts Neues. Es ist in der Schweiz nicht ungewöhnlich, dass der Staat weniger Gelder für die Wirtschaft spricht. Das gilt beispielsweise auch für die Tourismus-Förderung.
Das hat in der Schweiz damit zu tun, dass man immer wollte, dass das Subjekt selbst entscheidet wo und wie es Gelder einsetzen will. Mischt sich jemand finanziell ein, ist das immer auch damit verbunden, Einfluss auf Entscheide nehmen zu wollen. Das ist dem Schweizer irgendwie fremd und unangenehm und beschränkt die Eigeninitiative. Darum sind wir uns solche Umverteilungen weniger gewohnt. Den Unternehmen werden hier aber, verglichen mit anderen Ländern, weniger Steuern abgenommen. Darum gibt es auch weniger staatliche Gelder, die zur Verfügung stehen und verteilt werden könnten und die Unternehmen können die gesparten Mittel direkt dort einsetzen, wo sie ihnen den grössten Nutzen bringen. Wir haben schliesslich in der Schweiz sehr viele international aktive Unternehmen. Die meisten Unternehmen sind KMU. Sie gehen seit langem in die Welt und bauen oft mit einfachen Mitteln neue Märkte auf. Das zeichnet die Schweiz aus. Wenige Länder sind in anderen Ländern so erfolgreich unterwegs, wie das bei der Schweiz der Fall ist.
Dueblin: Sehr geehrter Herr Küng, was wünschen Sie sich für die Zukunft der Schweiz?
Daniel Küng: Dass wir weiterhin, wenn wir die Winde der Veränderung spüren, Windmühlen bauen – und nicht Schutzwälle!
Dueblin: Sehr geehrter Herr Küng, ich bedanke mich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen und der Osec weiterhin alles Gute!
(C) 2012 by Christian Dueblin. Alle Rechte vorbehalten. Anderweitige Publikationen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors gestattet.
______________________________
Links
– Business Network Switzerland